| |

Melanie Gerland: Offene Arme
Balance Buch + Medien 2010
128 Seiten, 19,95 Euro
» Balance
» amazon
|
Melanie Gerland
»Offene Arme«
Dass Comics mittlerweile in Gestalt von Graphic Novels verstärkt in fremde Gefilde vordringen, beweist, und zwar sehr eindrucksvoll, die Veröffentlichung von Melanie Gerlands Debüt aus dem Hause Balance, einem Bonner Fachverlag, der vornehmlich auf die Herausgabe psychologischer Beratungs- und Lebensratgeberliteratur abonniert ist. Die autobiographische Erzählung Gerlands, die an der Kunsthochschule Kassel Visuelle Kommunikation studiert und jüngst in der 98. Ausgabe des Strapazins mit einem Beitrag vertreten war, fügt sich vortrefflich in dieses Programm ein. Trotzdem bleibt zu wünschen, dass dem Werk eine möglichst große Aufmerksamkeit zuteil kommt: Denn Gerland weiß der stetig wachsenden Phalanx autobiographischer Comicgeschichten ungewohnte Aspekte abzutrotzen.
Dafür gibt es mehrere Gründe: die dezidiert weibliche Perspektive, die in dieser Gattung zumindest für den deutschsprachigen Raum nicht allzu zahlreich zu finden ist (und bislang kann das immense mediale Interesse an Ulli Lusts Meisterwerk »Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens« noch als Ausnahme von der Regel gelten) ; die Schonungslosigkeit, mit der sich Gerland in den Fokus der beklemmenden Erzählung rückt und der grafische Stilismus, mit dessen Hilfe sie die Hölle Pubertät als unkontrollierbare Vorhut der Autodestruktion narrativ übersetzt.
Das Aufwachsen in der bedrohlich-unbedrohlichen Tristesse der Provinzen ist als Sujet dem Comic zwar nicht fremd, aber der posthume Blick verrät oftmals nicht mehr als die artikulierte Freude darüber, nochmal glimpflich der dörfischen Hölle und ihren tumben Gesetzen der Bürgerlichkeit entkommen zu sein. Wie stark sich indes das letztlich folgenlose pubertäre Aufbegehren als Lebensphase zur handfesten Entfremdung, zur bedrohlichen Identitätskrise und zum vergeblichen Kampf gegen die Illusion der eigenen Austauschbarkeit verdichten kann, lässt sich mit gnadenloser Härte an dieser Geschichte nachvollziehen, die sich ebenso als Chronik eines Charakters lesen lässt, der die partiell unbeeinflussbare Eigendynamik von Selbst- und Fremdwahrnehmung nicht über den Mittelweg Verdrängung zu vergessen schafft.
Ablehnung ist quasi das leitmotivische Scharnier der Erzählung: Die 15jährige Melanie buhlt erfolglos um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern, ist in der Schule isoliert und immer wieder dem Gespött der Klasse ausgeliefert. Außerhalb der Schule versucht sie regelmäßig den aggressiven und gewalttätigen Attacken zweier besonders verhärteter Mitschülerinnen zu entkommen, über allem schwebt die Unfähigkeit, das Leid in adäquate Worte zu fassen: Zusammen mit ihrer Freundin Nicole wird stattdessen an Suizidfantasien gefeilt, in denen sich beide selig grinsend gemeinsam in den Tod stürzen. Als die zwei in einem leerstehenden Fabrikgebäude zufällig den Proberaum einer Metalband entdecken, tritt zur Ablehnung der Faktor Liebe als Refugium der inneren Machtlosigkeit hinzu. Melanie verliebt sich in den älteren Sänger Lewin, realisiert aber nicht, dass dieses Gefühl nur einseitig bleibt. Fortan besucht sie regelmäßig die Bandproben, versucht das Mobbing in der Schule mittels Imaginationen von Zweisamkeit mit Lewin zu ertragen, blondiert sich die Haare, nachdem sie hört, dass dies seine favorisierte Farbe ist, besucht die Konzerte, wartet stundenlang vor seiner Wohnung, um »spontan« auf ihn zu treffen und sich nach Hause fahren zu lassen – und beginnt sich die Arme zu ritzen, um so einen Liebesbeweis von ihm zu erhalten. Das Ritzen wird schnell zur Gewohnheit, wächst bald zum zweisamen Ritual mit Nicole und die Situation eskaliert vollends, nachdem sie am Telefon eine endgültige Abfuhr von Lewin erhält...
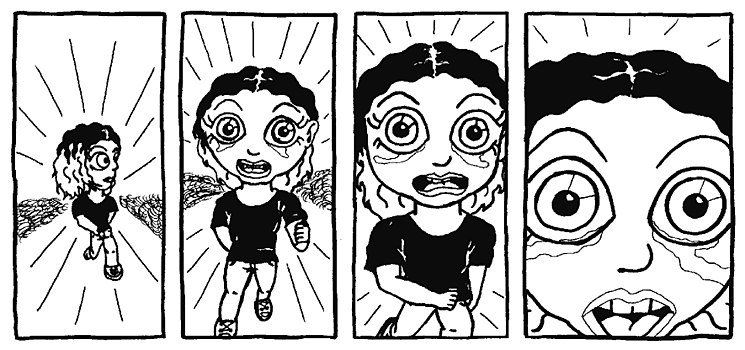
© BALANCE buch + medien verlag
Die Bildsprache, die Gerland wählt, ist schwarzweiß wie das Wahnsystem, dem sich ihre Figuren aussetzen (müssen). Hintergründe werden gelegentlich rudimentär angedeutet, oft bleiben sie auch leer. Das erhöht nicht nur den Eindruck von der mangelnden Sinnlichkeit dieses Kleinstadtkosmos, sondern macht auch immer wieder mit der Umweltwahrnehmung der Figuren gemeinsame Sache: Wenn Melanie beispielsweise zum ersten Mal den Proberaum verlässt und ihr Bauchkribbeln bemerkt, wird aus dem Schneetreiben und den skizzierten Häusern ringsum urplötzlich ein Frank Capra-artiges Bild der Vorstadtromantik und sie wandelt in dem Schein einer Straßenlaterne mit weit geöffneten Armen in einem Splashpanel dem Betrachter förmlich entgegen. Das Bild will also weniger einen Sachverhalt dokumentieren – wie man es bei einer autobiographischen Erzählung und dem ihr eben stets inhärenten, trügerischen Versprechen auf Authentizität erwarten würde -, sondern ordnet sich den Emotionen der Figuren unter. In diesem Sinne bleibt der Ort einer übergeordneten Erzählerinstanz diffus und wir blicken auf die, als auch mit der Figur.
So geraten die Gefühlswelten und die Frage nach ihren Funktionen in den erzählerischen Fokus. Und da wird schnell deutlich, dass das Versprechen auf Glück in einer rundherum glücklosen und abweisenden Welt über Projektionsleistungen erfüllt werden soll, die in ihrer steigenden Intensität einer Art innerem Exil ähneln. So wie das bösartige Mobbing der Mitschüler mit Schweigen und nach außen präsentierter Ruhe quittiert wird, wächst die Illusion einer Liebe als Rettungsanker in dieser buchstäblichen Hölle. Aber sie entflammt sich an Idealisierung und fehlgedeuteten Gesten, nährt sich aus irrealistischen Wünschen, weil das einzig verbindende Element der beiden Liebenden bzw. Nicht-Liebenden ihre gegenseitige Unkenntnis ist. Das ist auch eine Frage der geschlechtsspezifischen Form, die sich bereits im anhimmelnden Blick der jungen Mädchen auf die musizierenden Rockstars in spe findet, denn nach diesem sexistischen Urbild des Rockismus und seiner Mythologie des Begehrens folgt schließlich der Rückfall in die Realität, die mit all den Heilsversprechen dieser Fantasie nichts am Hut hat.
Letztlich führt Gerland ergreifend und differenziert (und in der Wahl der Methode eben auch exzellent comicspezifisch) zugleich vor, wie das permanente Erdulden von Qual und Ablehnung zu einer paradoxen Flucht in den Selbsthass führt und wie dieser wiederum aus einem mental unlösbaren Systems des entweder-oder sich speist, so wie sich auch im Ritzen Todessehnsucht und Hilferuf vereinen (und diese Ambivalenz erzeugt ebenfalls das Antlitz der Figuren, deren starken Konturen und expressiven Augen eine Präsenz besitzen, der sie sich selber wohl lieber zu entziehen versuchten). Das macht die Geschichte gleich doppelt interessant: Sie funktioniert auf sehr kluge Weise als pädagogisches Aufklärungswerk und ruft gleichzeitig in Erinnerung, inwiefern der Lebensabschnitt Pubertät weit über die geduldeten Grenzen der Desorientierung hinaus zur handfesten identitären Krise reifen kann – und das dies mehr mit der Verfasstheit von Gesellschaften statt individualpsychologischen Gründen zu tun hat. Eine wichtige Bereicherung für das weite Feld autobiographischer Comicerzählungen ist dieses Buch ohnehin.



