| |
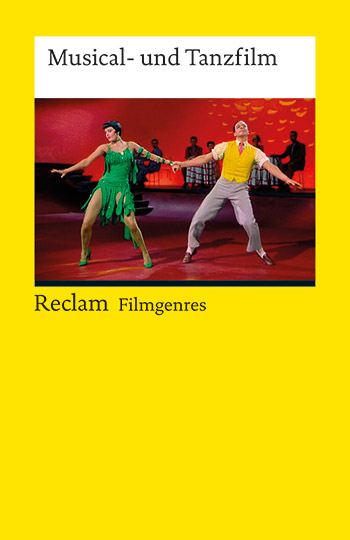 »Musical- und Tanzfilm«
(Reclam Filmgenres)
Herausgeber: Thomas Koebner, Dorothee Ott
Stuttgart, Ditzingen: Reclam 2014 (Reclams Universal-Bibliothek, 18410)
424 Seiten, € 12,00
ISBN 978-3-15-018410-3
» Verlag | amazon
|
Let’s Dance
Neue filmwissenschaftliche Reflektionen zum »Musical- und Tanzfilm«
Es ist sicherlich kein Zufall, dass dieses kleine aber seitenstarke Büchlein innerhalb der bei Reclam erschienen Reihe über Filmgenres erst so spät herauskam. Nicht nur, dass die große Ära des klassischen Musical- und Tanzfilms längst vorbei ist, das Genre ist außerdem viel seichter und leichtfüßiger als die meisten anderen und damit wissenschaftlich nicht ganz so einfach in den Griff zu bekommen. Vor allem aufgrund seiner impliziten und expliziten Erotisierungen ist es oft schlüpfrig und manchmal wird erst durch große zeitliche Abstände eine angemessene Rezeption überhaupt möglich. In dem bei Reclam erschienen Buch wird daher vor allem immer wieder die Frage der Realitätsebene gestellt und wie es den Filmen gelingt ihre virtuelle Seite (die der Gesangs- und Tanzszenen) mit einer näher an der Realität orientierten Handlung zu verknüpfen. In der Einleitung, wo das Genre von den Herausgebern definiert wird, ist von emotionalen Ausnahmezuständen die Rede, deren Intensität sich in Tanz und Gesang Ausdruck verschafft (S. 10). »Wenn die Worte nicht ausreichen, beginnt der Körper durch den Tanz zu sprechen« (ebd.). Der Psychoanalytiker spricht dann von einem Acting out, wenn eine Handlung nicht symbolisch mithilfe der Sprache verarbeitet werden kann, sondern ihr Impuls so stark ist, dass er in der Realität irgendwie ausgelebt werden muss. Oder er spricht von Hysterie (einer psychischen Krankheit, die keineswegs nur Frauen betrifft), wenn sich ein seelischer Zusammenhang in körperlichen Symptomen ausdrückt. Beide Beschreibungen würden auf dieses Genre durchaus zutreffen, wobei die zweite Beschreibung die präzisere Annäherung liefert.
So beginnt das Buch auch nicht zufällig mit der berühmten Tanzszene mit Gene Kelly aus Singin' In The Rain (1952) und beschreibt den Mann (Kelly), der aus lauter Übermut im Regen tanzt als »ein wenig verrückt« (S. 9). Dazu passt, dass die Szene mit einem Polizisten endet, der den Tänzer metaphorisch wieder zur Ordnung ruft. Der Musicalfilm zeichnet sich oft durch »eine Übersteigerung der Realität ins Künstliche« aus (S.11). Affekte werden dabei scheinbar unmittelbar und kompromisslos in Gesang und Bewegung übertragen. Weil dabei nur der Augenblick und die Intensität des Erlebten zählt, handelt es sich tatsächlich um eine hysterische Ausdrucksweise. Und daraus ergeben sich für die aktuelle Rezeption keine geringen Schwierigkeiten, da der heutige Zuschauer innerhalb der westlichen Zivilisation nicht mehr bereit ist solche Gefühlsausbrüche, wenn sie nicht extrem gut motiviert und mit dem Rest der Handlung verknüpft sind, einfach hinzunehmen. Allzu rasch wacht er sonst aus dem Kinotraum auf und findet ihn lächerlich.
Und in einigen Fällen war das auch schon früher so. So wurde beispielsweise das in den USA extrem erfolgreiche und wundervolle Familien-Musical The Sound of Music (1965), welches in Österreich spielt, im deutschsprachigen Raum vollkommen ablehnt (S.187), weil die darin dargestellte naive Haltung sich überhaupt nicht verbinden ließ mit der Realitätswahrnehmung der eigenen Lokalitäten. Dieser Aspekt wird von Janine Schulze in ihrem Aufsatz über den Film sehr genau wiedergegeben. Sie stellt dabei vor allem da, welche Wirkung der Film im heutigen Österreich hat. In The Sound of Music wird die überschwängliche (hysterische) Gefühlswelt der Hauptperson (Julie Andrews) zunächst mit der hartherzigen und pedantischen (zwanghaften) Ordnungsliebe eines Witwers (Christopher Plummer) konfrontiert. Überhaupt muss in einem Genre, in dem es so offensichtlich um die überschwängliche Lobpreisung des Glücks, der Liebe und der positiven Gefühle geht, fast immer ein Gegengewicht hergestellt werden, damit seine Artikulationen nicht den Eindruck von purer Naivität hinterlassen.
Ein weiteres genretypisches Problem ist die enge Verbindung zum Theater. Durch den unmittelbaren Ausdruck der Gefühle in Tanz und Gesang wird die körperliche Ebene der Schauspieler so extrem herangezogen, dass dieses Genre eigentlich in Live-Darbietungen auf der Bühne zuhause ist. Das Kino wird damit zu einem Ort der Zweitverwertung, welchem häufig eine bekannte Theaterinszenierung vorausging. Dieser Zusammenhang wird von nahezu allen Autoren/innen des Buches immer wieder eingehend thematisiert und so die spezifische filmische Umsetzung kommentiert. So weißt Thomas Koebner beispielsweise in seinem Aufsatz über Cabaret (1972) gleich am Anfang darauf hin, dass die Verfilmung von Bob Fosse sich erheblich von dem Broadway-Musical unterscheidet (S. 204), zugleich finden aber alle Tanz- und Gesangsszenen in dem Film dann wieder auf einer Bühne statt und werden von ihm dann auch zu Recht als roh, derb, possenhaft und theatralisch beschrieben. Nicht selten beziehen sich die Verfilmungen so unmittelbar auf das Theater und partizipieren damit an einer anderen Kunstform. Das ist einer der Gründe, dass die Form des Musicals heute zwar als Live-Darbietung die Massen anlockt aber es zugleich im Kino keine serielle Produktion von Musical- und Tanzfilmen mehr gibt (S. 18). Der verwöhnte Zuschauer will affiziert werden von der Präsenz und Aura der Bühne und nicht eine reproduzierbare Konserve betrachten. Die Hysterie will immer im hier und jetzt sein. Diesem Problem haben sich die filmischen Produktionen der Gegenwart in unterschiedlichen Formen gestellt.
Insgesamt werden in dem kleine Buch von 19 Autoren/innen die Grundlagen und die bisherige Geschichte des Musical- und Tanzfilms beschrieben und anhand von rund 90 Filmporträts sorgfältig und im Detail analysiert. Das Hintergrundwissen bei den Artikeln ist unterschiedlich groß, zum Teil aber sehr umfangreich und war sicherlich mit vielen Vorarbeiten verbunden. Größere Anteile sind von den beiden Herausgebern selbst verfasst worden. Es ist zudem in dem angenehm zurückhaltenden und entspannten Ton filmwissenschaftlich, sachkundiger Zeugen/innen geschrieben. Diese wissenschaftliche Anthologie ist gut lesbar und will vor allem umfassend über die einzelnen Filme informieren und beim Leser Interesse für sie wecken. Es geht mehr um Taxierungen der Werke, zuweilen aber auch um Kritik. Die handlungsorientierten Deutungen ermöglichen ein rasches Verständnis, ohne dass die Leser/innen die Filme unbedingt gesehen haben müssen. Auch besonders schwierige Musicals, wie beispielsweise Lars von Triers Dancer in the Dark (2000), das einen Versuch darstellt, durch Kippbewegungen das Genre selbst nochmals zu feiern und gleichzeitig zu dekonstruieren (S. 355), werden (in diesem Fall von Janswillem Dubil) sehr gelungen analysiert.
Es fehlt kaum ein Klassiker, auch wenn eine Produktion wie Gentlemen Prefer Blondes (1953) mit Marilyn Monroe hier nicht nochmals portraitiert wurde. Der Film wird aber zumindest genannt (S. 196). Dasselbe gilt auch für die neueren indischen Tanzfilme aus Bollywood (S. 371), die aber vielleicht eine längere Betrachtung verdient hätten, zumal sie auch einen gewissen Einfluss auf das amerikanische Gegenwartskino haben. Einige Raritäten werden dafür sehr ausführlich und enthusiastisch besprochen, wie beispielsweise das Musical Hot Blood (1956) von Nicolas Ray. Norbert Grob beschreibt diesen Film durch die Perspektive von Jean-Luc Godard als einen reinen Tanzfilm, als reines Kino und findet viele Attribute, die diese Kennzeichnung legitimieren. Die spektakuläre Szene, in der Jane Russell zu den Peitschenschlägen eines Mannes tanzen muss, lässt er aber leider aus.
Der frivole Aspekt des Genres wird überhaupt häufig mit Amüsement goutiert und weniger aufgeschlüsselt. So werden Genderthemen überhaupt von den Autoren/innen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Am Anfang des Buches wird schon erklärt, dass der Paartanz ohnehin seit jeher den Liebesakt symbolisiert habe (S. 16) und damit nicht unabhängig von der Erotik gedacht werden kann. Dieses Verständnis hängt mit der Inszenierung von Geschlechterrollen natürlich eng zusammen und wird dann später beispielsweise von Dorothee Ott bei ihrer Beschreibung der Paartänze von Fred Astaire und Ginger Rogers auch wieder aufgegriffen (S. 79). Auch Marisa Buovolo erklärt in der Besprechung von Le Bal – Der Tanzpalast (1983), dass sich der Tanz hier als Treffpunkt der Geschlechter in verschiedenen Epochen zeigt (S. 267). Auf der anderen Seite werden aber auch Dekonstruktionen des erotischen Tanzes, wie beispielsweise in dem Film Pina (2011) von Wim Wenders über die Choreografin und Tänzerin Pina Bausch sehr ausführlich dargestellt (S. 400ff.). Thomas Koebener beschreibt darüber hinaus auch wie das Gender-Crossing schon in alten Produktionen, wie beispielsweise Viktor und Viktoria (1933) auftaucht (S. 38). Wie in dem gesamten Buch gibt es hier eine große Sensibilität für den Einfluss und die Darstellung des deutschen Faschismus auf die Filmgeschichte. Dass dieser Aspekt immer wieder auftaucht gehört zu Vorteilen der Studie. In diesem Fall erklärt Koebener, dass Viktor und Viktoria durch die Androgynität seiner Hauptdarstellerin Renate Müller, dem damaligen Zeitgeist völlig zuwiderlief. Denn unter Hitler war Deutschland 1933 gerade dabei zu der konservativen Einteilung zwischen »heroischen Männern und duldenden Frauen« zurückzukehren (ebd.).
Andere Autoren/innen hingegen interessieren sich aber nach meiner Ansicht zu wenig für die Ebene filmischer Repräsentation von Geschlechtlichkeit, die in diesem Genre besonders wichtig ist, weil sie zur Inszenierung eines hysterischen Ausdrucks (hier, jetzt und alles) gehört. Besonders signifikant für den unkritischen Umgang damit ist beispielsweise, dass in dem Aufsatz über Busby Berkeley und seine Kunst von Armin Jäger Siegfried Kracauers grundlegender Aufsatz Das Ornament der Masse (1928) zwar verwendet wurde, aber nicht einmal in den Literaturangaben angegeben wird. Kracauers kritische Ideen, wie die Ornamente, die vorwiegend aus tanzenden weiblichen Körpern gebildet wurden denn zu deuten seien, findet demnach hier keine Verwendung. Noch schwerwiegender ist dieses Defizit bei einigen Porträts neuerer Filme spürbar, wie beispielsweise Flashdance (1983), Moulin Rouge! (2001) oder Chicago (2002). Hier werden sexistische oder chauvinistische Aspekte zugunsten neutraler (wenngleich auch sehr genauer) Beschreibungen der Körperinszenierungen nahezu vollkommen ausgeblendet. Obwohl Kerstin Gutberlet sehr ausführlich das simple Drehbuch zu Flashdance kritisiert, folgt ihrer Beschreibung der durch die Montage hergestellten Fragmentierung der weiblichen, tanzenden Körper kein kritischer Kommentar. Sie deutet die Möglichkeit dieser Ebene nur kurz an (S. 309). Julia Steimle geht auf die Klischees in Moulin Rouge! nicht einmal ein, aber sie beschreibt dafür präzise die verschiedenen Erzählebenen in den sich das Drama vor dem Kinozuschauer entfaltet. Hier weist sie auch auf den engen Bezug zum Theater hin. Über die hysterischen Verführungskünste einer Kurtisane (Nicole Kidman), die als eine aufwendig konstruierte Männerfantasie in Szene gesetzt wurde, erfahren die Leser/innen hingegen leider nichts. Damit kommt auch die oberflächliche Werbefilmästhetik eines Adrian Lyne oder der letztendlich bizarre Hedonismus eines Baz Luhrmann bei der Inszenierung von Moulin Rouge! ziemlich kritiklos davon. Andere Autoren/Innen, wie beispielsweise Janine Schulze, die Fame (1980 analysiert, oder noch mehr noch Marisa Buovolo in ihrem Aufsatz über Saturday Night Fever (1977) zeigen sich da weitaus kritischer. Sie kommen auf die hier vorgeführte problematische Darstellung der Geschlechterverhältnisse, die im ersten Fall versehen sind mit vielen Klischees und Stereotypen (S. 263) oder im zweiten Film mit männlicher, »narzisstischer Selbstdarstellung und phallischer Stärke« (S. 246) ausgestattet sind, durchaus zu sprechen. Genderthemen aus den 70ziger Jahren lassen sich finden in der Analyse von The Rocky Horror Picture Show (1975) durch Andreas Friedrich. Dabei wird der Hauptdarsteller Tim Curry sogar als eine Mischung von David Bowie und Mick Jagger gesehen (S. 242). Sehr detailliert beschreibt Friedrich auch die Gründe für den Kultstatus dieses Films. Der Frage, warum hier das bisexuelle Spiel der Geschlechter aber ausgerechnet mit dem Horrorfilm assoziiert ist, wurde leider nicht weiter nachgegangen.
Ursula Vossens eingehende Betrachtung von Carlos Sauras Tanzfilmen (S. 292ff.) halte ich insgesamt für sehr gelungen und im Kontext des Buches für sehr hilfreich, weil nochmals einen ganze andere Art von anspruchsvollerem Tanzfilm erläutert, der aus der Folklore und dem europäischen Autorenkino kommt. In Bezug auf die zwei Ballettfilme The Red Shoes (1948) und Black Swan (2010) wird das Pygmalionthema dann von Alexander Bartl sehr scharf herausgearbeitet (S. 274), und seine Fragwürdigkeit durch die überhebliche Position eines männlichen Drillmeisters, der seine Primaballerina formt, auch eingehend thematisiert. Dabei erklärt Bartels sehr genau, wie sich eine fünfzehnminütige Tanzszene auf der Bühne in The Red Shoes nahtlos in den Rest der Filmhandlung integrieren konnte (S. 277f.). Verbunden sind diese Betrachtungen mit der berühmten Verfilmung von George Bernard Shaws Theaterstück Pygmalion (1913) My Fair Lady (1964), wo sehr genau die absurde Position eines väterlichen Lehrers gegenüber seiner unbedarften Schülerin beschrieben wird. Hier wird nicht nur die ebenfalls für die Hysterie typische »Vater-Tochter-Konstellation« (S. 181) genannt, sondern auch die Vaterfigur als eine Art Sherlock Holmes, einen sich selbst genügenden Narziss (S. 183) vortrefflich charakterisiert.
Insgesamt enthält das Büchlein oft wiederkehrende Motive, die eine gewisse Geschlossenheit aufweisen. Gleichzeitig wird aber die demokratische Vielfalt durch die hohe Anzahl der Autoren/innen und und ihr Spezialwissen spürbar, die erheblich zum Reiz der Lektüre beiträgt. Das ein so langer Zeitraum, wie der zwischen 1927 bis 2012 sich nicht wirklich auf 424 Seiten ausloten und nacherzählen lässt, ist selbstverständlich. Dennoch werden hier immer wieder interessante Einblicke gewährt und erklärt wo die Highlights sind. Insgesamt eine sehr gelungene Einführung in das Genre, die allen enzyklopädischen Neigungen ein optimales Startkapital an die Hand gibt.
Ein Sonderkapitel von Dorothee Ott am Ende rundet das Kompendium dann ab. Es handelt von der Verwendung der Musik im Animationsfilm und schließt damit eine weitere Lücke und integriert neben vielen Disneyfilmen auch skurrile Formen wie die Muppet Show sehr gekonnt in den Kanon der Musicalgeschichte (S. 412). Überhaupt ist es sehr angenehm, dass sich dieses Buch keine Sekunde lang den innovativen Einflüssen der Popmusik innerhalb des Musical- und Tanzfilms verweigert, sondern im Gegenteil in ihnen eine Fortsetzung des klassischen Musicals mit anderen Mitteln sieht. Damit wird ein Bruch vermieden, der mir auch unproduktiv erscheinen würde.
Sehr lesenswert als Einführung für Anfänger, aber zugleich auch ein gutes Nachschlagewerk für Fortgeschrittene, da es viele Informationen in gebündelter Form und vor einem professionellen Hintergrund in sich versammelt. Und mit 12 Euro für jedermann erschwinglich.


