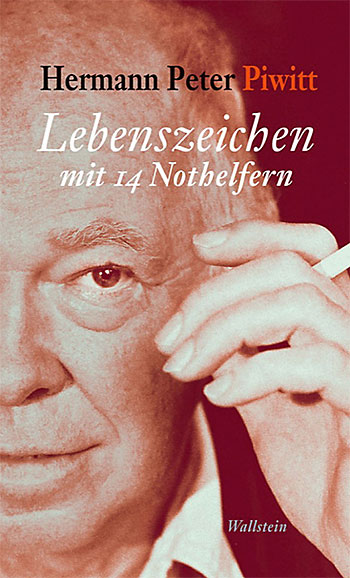| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
|
3. Mai 2014 |
Jörg Auberg
für satt.org |
||

|
Nicht versöhntIn den 1970er und 1980er Jahren gehörte Hermann Peter Piwitt zu den prominenten linken Autoren, die auch in den liberalen Feuilletons jener Zeit zu Wort kamen. Danach geriet er aber mehr und mehr zur Randfigur, die schließlich in den Club der vergessenen Dichter abgeschoben wurde. In seinem schmalen Erinnerungsband »Lebenszeichen mit 14 Nothelfern« hält er kritisch Rückschau auf das eigene Leben wie auf die bundesrepublikanischen Verhältnisse.
»Die Zeit ist kaum erzählbar.« Im Sommer 1969 rezensierte der 34-jährige aufstrebende Autor Hermann Peter Piwitt im Spiegel den Essay Über das Altern des 56-jährigen Autors Jean Améry und sinnierte in einer Zeit der Jugend-Idolatrie – »nach der Pelz- und Ledermodenschau der Apo im letzten Winter« – über das »soziale Altern« wie über das »frühe Altern im Geld- und Warennexus der menschlichen Beziehungen«. 45 Jahre später legt der nun selbst alt gewordene Autor den schmalen Band Lebenszeichen mit 14 Nothelfern vor, in dem er Stationen und Geschehnisse seines Lebens in fragmentarischen, knappen Erinnerungen Revue passieren lässt. »Sind achtzig Jahre ein Leben?«, fragt er zu Beginn des Buches, ohne eine Antwort darauf zu geben. Manchmal schien es ein »Scheißleben« gewesen zu sein. 1935 in Wohldorf geboren, wuchs Piwitt in Hamburg und Frankfurt am Main auf. Sein Vater war ein kleiner Funktionär im Räderwerk des nationalsozialistischen Systems, ein Kameradschaftsführer im Gefüge einer umfassenden kriminellen Organisation, und die Familie konnte bis zum Untergang des deutschen Reiches eine privilegierte Existenz in einem Haus mit zwölf Zimmern und ständig wechselnden Dienstmädchen führen. In der eindringlichen Beschreibung des Familienlebens im Hause Piwitt tritt die Alltäglichkeit der autoritären Herrschaft zutage. Selbst Sexualität zwischen Vater und Mutter im nationalsozialistischen Haushalt wird als Akt der Herrschaft und Unterwerfung im gegenseitigen Einvernehmen pflichtschuldig und lustlos vollzogen. So setzt Piwitt einen klaren Kontrapunkt zu verklärenden deutschen Familiengeschichten, wie sie seit den 1970er Jahren in Mode kamen. Deren relativierenden Tenor, der die Barbarei mit Anekdoten aus dem bürgerlichen Fundus übertünchte, setzt Piwitt mit knappen, scharfen Szenen schroffe Gegentöne entgegen. Vom Gefühl getrieben, in die falsche Welt mit den falschen Personen hinaus gezerrt worden zu sein, entwickelte sich Piwitt als renitenter Opponent, dessen primäre Maxime »Ich wußte nur, ich wollte nicht werden wie sie« war. In dieser Verweigerungshaltung lavierte er sich durch das Gymnasium, absolvierte ein Studium bei Theodor W. Adorno und etablierte sich als Schriftsteller im Endstadium der Gruppe 47, ehe er in den späten 1960er Jahren und danach als einer wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller reüssierte. Zusammen mit Kollegen wie Rolf Dieter Brinkmann, Nicolas Born, Jürgen Theobaldy und Michael Schneider gehörte er zu den Autoren, die in Rowohlts Literaturmagazin gesellschaftskritisches Engagement und künstlerischer Avanciertheit verbanden. Im Laufe der Jahre verschwanden diese Autoren jedoch aus dem kulturbetrieblichen Fokus, weil sie – wie Brinkmann und Born – früh starben oder von den Betriebsangestellten als nicht mehr zeitgemäß betrachtet wurden. Im Gegensatz zu anderen arbeitete Piwitt nicht kontinuierlich und zielstrebig an seiner Karriere, sondern lebte als Bohemedichter zuerst in Berlin und später in Hamburg von der Hand in den Mund. In den 1970er und 1980er Jahren war er in den maßgeblichen Feuilletons der bürgerlichen Presse vertreten, doch zunehmend wurden die Publikationsmöglichkeiten in Zeiten des Einheitsjournalismus und der vollkommenen Austauschbarkeit des Mainstream-Medienpersonals rarer, sodass er schließlich »des guten Umgangs wegen« nur noch für die Monatszeitschrift konkret und die Wochenzeitung Freitag schrieb. »Wir hatten uns von der Welt der Medien getrennt, bevor man uns rausschmiss«, resümiert Piwitt. »Wie weise wir gewesen waren!« In seiner Kritik der Medienentwicklung in der Bundesrepublik blendet Piwitt freilich aus, dass auch die linke Publizistik von der Logik des Zerfalls gekennzeichnet ist: Wie in anderen redaktionellen Arbeitsstätten sind auch dort windschnittige Opportunisten anzutreffen, und Engstirnigkeit, Borniertheit und willfährige Komplizität mit den je herrschenden Verhältnissen haben an diesen Orten ebenfalls eine Heimstätte gefunden. Ein Gefühl der Bitterkeit und des Grolls, aber auch der Renitenz und Unbeugsamkeit ist dem Buch eingegraben. Es äußert sich nicht allein in der Kritik des Kulturbetriebs, der Piwitt als Autor marginalisierte (sein langjähriger Verlag Rowohlt tilgte ihn aus seinem Autorenverzeichnis und stempelte ihn zur Unperson), sondern auch in der Beschreibung der Stadt Hamburg, in der er seit mehr als vierzig Jahren lebt und nicht heimisch wurde. In Piwitts Augen ist es ein Ort der Krämerseelen und kulturlosen Kapitalisten, und seine Bewohner kaschieren ihre Unbildung als Arroganz. In der urbanen Gentrifizierung lebt das Untote schließlich weiter als »Hipster«, der das kapitalistische Regime mit einem ständig wechselnden falschen Schein umgibt. »Wie sie andocken, die Zombies«, kommentiert Piwitt die Umgestaltung von Stadtteilen wie dem Schanzenviertel, »an die Milieus, um ihnen das bisschen Leben auszusaugen; und es schließlich zu erwürgen ...« Darüber hinaus wurde sein zeitweiliger Zufluchtsort – ein kleines Dorf in Umbrien – im Laufe der Jahre von Profitstreben und Raffgier überwältigt und vom »Raffgardinenmilieu der Nachgeborenen« okkupiert. Dann und wann überkommt ihn der Ekel an der Zeit. In beckettesker Manier stockt der autobiografische Erzähler dann und wann, will abbrechen oder von Dingen nicht erzählen (»Mach ein Ende. Es gibt nichts mehr zu erzählen.«), hadert mit dem Älter- und Altwerden. »Altwerden ist wirklich das Dümmste, was einem passieren kann«, ruft Piwitt aus, nachdem er sich mit dem Alter auch Krankheiten, Krankenhausaufenthalte und Operationen einhandelte. Trotz allem gilt es weiterzumachen, denn im Gegensatz zu vielen Weggefährten und Freunden gelang ihm das Überleben. Dank einiger »Nothelfer« wie des früh verstorbenen Dichterfreundes Wolfgang Maier oder des konkret-Herausgebers Hermann L. Gremliza, die ihm in den vergangenen acht Jahrzehnten helfend zur Seite standen, konnte er gegen das Vergessenwerden die Stimme erheben, um das eine oder andere Lebenszeichen zu senden. Letztlich ist dieser kurz gehaltene Erzählband eine Flaschenpost, mit der nicht allein die Negation des Vergessens transportiert wird, sondern auch der Stoff einer untergründigen Erinnerung, die als Gegenbewegung zu den Beutezügen der herrschenden Geschichtsschreibung fungiert.
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |