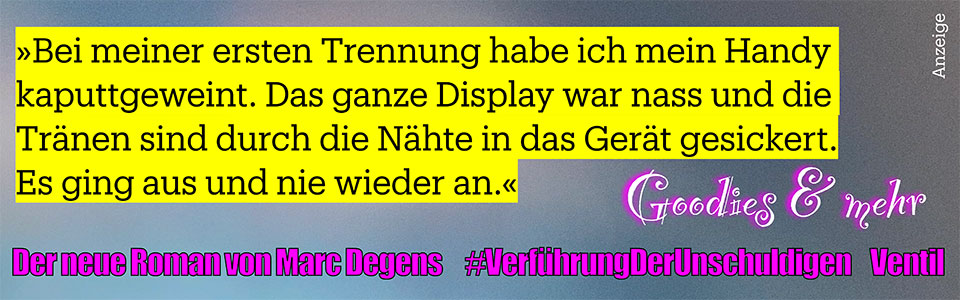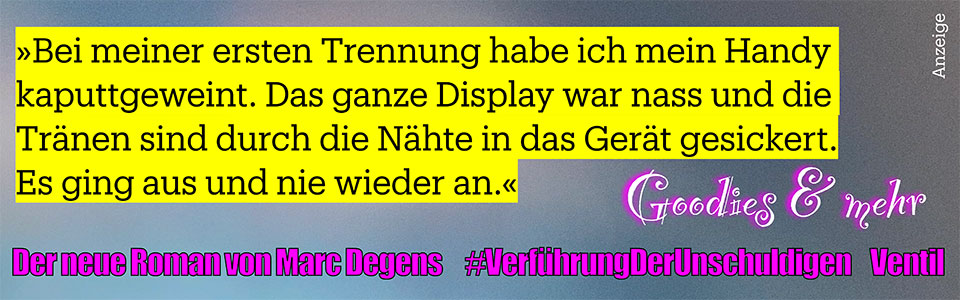Christian Kracht:
1979.
Kiepenheuer u. Witsch
Köln 2001
183 Seiten, geb.
DM 34,90
EUR 17,84

Bestellung bei
amazon.de
|
|
Viel Lärm um Nichts.Christian Krachts neuer Roman.
Nachdem Christian Krachts "1979" in fast allen Literaturbeilagen und Feuilletons besprochen worden war, der Autor sogar in der "Harald Schmidt Show" einen Auftritt absolvierte und in Harald Schmidt auch noch einen engagierten Fürsprecher gefunden hatte, da war es eigentlich schon zu spät, dieses Buch zu lesen. Wer wollte schon noch darüber reden? Alle schienen entweder irritiert oder amüsiert (meistens beides). Aber allem Anschein nach bot das Buch keinen Punkt, an dem man eine Debatte hätte entzünden können. Durch den Krieg in Afghanistan meinten die Redakteure, verdiene es besondere Aufmerksamkeit und damit einen vorderen Platz in den Beilagen. Vielleicht würde es ja einiges über das Verhältnis des fundamentalistischen Islam zum kapitalistischen Westen verraten, denn schließlich spielt das Buch zur Hälfte im revolutionären Teheran des Jahres 1979 - so dachte man sich wohl. Und hatte sich Kracht mit seinem poppigen 95er-Debüt "Faserland" nicht als ganz herausragendes Exemplar der Spezies Konsument geoutet? Musste es da nicht krachen, wenn so einer auf einen Haufen Tschador-Trägerinnen trifft?
Nein, es kracht nicht. Und die erste Hälfte des Romans ist auch völlig uninteressant, nichts weiter als der Versuch sich von poppigen Allüren loszuschreiben. Im zweiten Teil, der die Pilgerreise des Erzählers nach Tibet und sein Schicksal in einem chinesischen Umerziehungslager erzählt, findet sich dann auch keine Beschreibung ausgefallener Interieurs mehr, kein kennerisches Abwägen der richtigen Kleidungskombination, kein knackiger Musikkommentar, keine verkokste Party. Befreit von all diesen Oberflächlichkeiten, die auch den ersten Teil des neuen Buches noch schwer verdaulich machen, präsentiert sich im zweiten Teil die völlige Leere. Der aufgesetzten Ersatzwelt der Konsumgesellschaft und ihren Heimatorten, den großen Städten des Westens und deren nahöstlichen Dependancen entflohen, bietet Kracht keinen Gegenentwurf, sondern einfach das Nichts. Und das ist überzeugend und ehrlich. Die Wüste Lop Nor und ihr autistischer Zuzügler, in ihnen ist jede Ersatzhandlung außer Kraft gesetzt, sie verweigern sich aller Metaphysik und erlangen dadurch tatsächlich erhabene Qualität. Dass der Erzähler seinen entrückten Zustand mithilfe der Mao-Bibel erreicht und nicht durch buddhistische Gebetstechniken, ist zwar erstaunlich, bleibt aber letztlich ein Zufall.
Im Interview hatte Kracht gesagt, dass er beim Schreiben des Romans ständig hatte lachen müssen, da er das meiste, was er da zu Papier brachte, so wahnsinnig kitschig fand. Der erste Teil allerdings regt nicht zum Lachen an, sondern ist einfach lächerlich und auch nicht kitschig, sondern einfach banal. Im zweiten Teil des Buches wird ein etwas anderer Tonfall angeschlagen, der in umgekehrter Richtung das beweist, was Napoleon einst konstatierte: "Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt". Leider ist das Buch insgesamt nicht besonders gut geschrieben, sonst hätte es vielleicht noch eine Chance in der Wissenschaft, da es sich seine Chancen im Feuilleton allem Anschein nach verspielt hat.
|