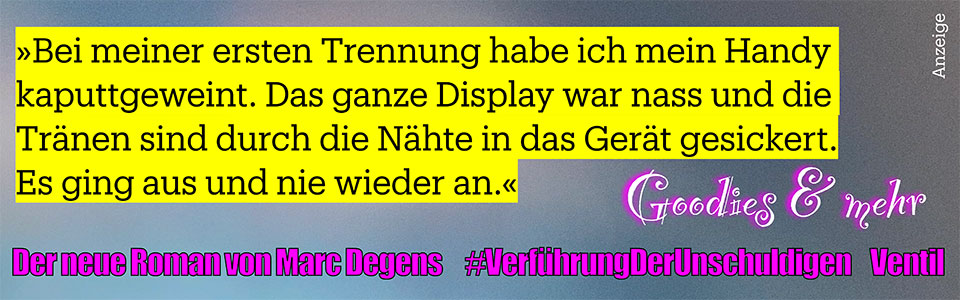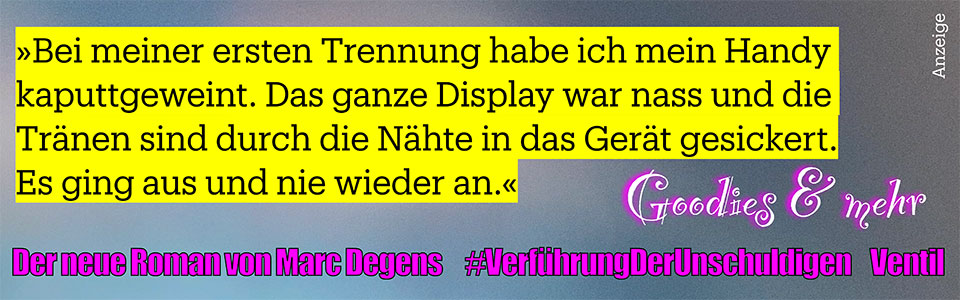Fünf Menschen, vier Männer und eine Frau, sitzen in der zehnten Etage eines verlassenen, mit den Jahren heruntergekommenen Hochhauses am Alten Salzhafen der Stadt und blicken durch die verschmutzten Fenster auf die vor ihnen liegende Flusslandschaft. Sie dürfen das Haus nicht verlassen, denn sie wurden von Gabor Cziffra auf die Suche nach der Sonne geschickt. Sie benennen sich nach den von ihnen bevorzugten Getränken, die sie im großen, lärmenden, aber ineffektiven Kühlschrank finden: Lemon, Still, Light, Vita und Funny und begeben sich auf die Suche.
Der erste und letzte der drei Teile sind von Lemon verfasst, dessen Lieblingsgetränk Bitter Lemon war. Er erläutert das absonderliche Unternehmen aus seiner Sicht "Wir sind Kollegen auf Zeit. Und vielleicht, wer weiß, bin ich Gabor Cziffras Buchhalter. Gut könnten die anderen vier dies von mir denken, denn ich halte, seit wir beisammen sind, ein schmales Buch unter den rechten Arm geklemmt." Die Unbestimmtheit der individuellen Rolle scheint dabei dem verordneten Charakter des Kollektivs geschuldet: "Herr Gabor Cziffra hat mich bei seinem Anwerbungsanruf ausdrücklich darauf hingewiesen, daß meine Kollegen nicht meine Freunde werden müßten. Unsere gemeinsame Zeit sei begrenzt, nur die Suche und ihr Ziel zählten und so sei auch das Territorium unserer Gefühle zweckdienlich abgesteckt." Nur Funny, der Dicke, hält dem Druck dieser "produktiven Solidarität" nicht statt und erzählt von seiner Anwerbung und seinem finanziellen Benefizium. Musste er deswegen sterben, nachdem er aus Versehen aus der Heizölflasche getrunken hatte? Die restlichen vier beerdigen ihn. Im Keller findet man eine vergorene Leiche mit einer Keule in der Hand. Diese scheint dem Sex-Darsteller Vita die offenkundig außergesetzliche Natur der Lokalität ins Gedächtnis zu rufen, und er versucht, seinen Anteil am großen Kuchen durch Auslöschung der Person Lights zu vergrößern, was ihm nur zeitweise gelingt. Tatsächlich war das mumienartige Wesen der syrische Wachmann Cziffras gewesen, der als erster einen vorchristlichen Schatz aus dem sich auf dem Gelände des Hochhauses vormalig befindlichen "Museum der Weltmirakel" aufgestöbert hatte. Dieses hatte Ilja Gunter Gor im Gebäude des von dem jüdischen Stararchitekten Egon Zucker (gemeint sein könnte der Architekt Erich Mendelssohn, 1887-1953) gebauten Kinos Lux 27 eingerichtet. Es war Zuckers letzter Jugendstilbau gewesen, bevor er in die Hauptstadt ging und sich von der üppigen Ornamentik verabschiedete. Das Museumskino war eines der wenigen im Krieg zerstörten Gebäude im Salzhafenviertel gewesen; seitdem gelten viele seiner Stücke als verschollen. Die Keule scheint wiederum auf den in den letzten Monaten umgehenden Keulenmörder hinzuweisen, der schon vier Menschen umgebracht hat.
Während im Keller also ein darwinistischer Kampf ausgebrochen war, hatten Still, die Graphologin, und Lemon, der somnambule und legasthenische Tunichtgut, eine ins Haus geschmuggelte Hasch-Zigarette geraucht und sich einem wilden Liebesrausch hingegeben. Als Vita, mit altertümlicher Keule bewaffnet aus den Tiefen des Gebäudes aufsteigend, sich daran macht, auch diese beiden Konkurrenten zu eliminieren, findet er zunächst niemanden, sondern wird schließlich vom Racheengel Light gefunden, der ihn bewusstlos schlägt. Diesem fällt mit Lemons Hilfe schließlich die "Sonne", ein Bernstein aus dem Museum Gors, unter merkwürdigen Umständen in die Hände. Als Cziffras Gehilfe, der Rechtsanwalt Heribert Boxfeld, Still, Lemon und dem verletzten Vita den Lohn auf dem Dach des Gebäudes auszahlt, ist Light nicht mehr anwesend. Er ist mit der Sonne geflohen.
"Die Sonne scheint uns" steht ganz in der Linie der bisherigen Kleinschen Schauerroman-Kriminalgeschichten (Libidissi, Barbar Rosa, Die Deutschen), die uns auf ungemein elegante Weise in ihre fremden, eigensinnigen und mythologischen Welten entführten. Mehr als bisher jongliert der Autor aber nicht nur mit den Genres (um einen Horrorroman, wie es im Klappentext heißt, handelt es sich nur wirklich nicht), sondern auch mit uns. Immer weniger scheint es ihm um die erzählte Handlung und um das finale fachgerechte Entwirren der im Laufe des Romans so kunstvoll und spannend geflochtenen Zöpfe zu gehen. Ein völliges Entwirren der reichlich gelegten Spuren und Verweise, gelegentlichen Details und Abschweifungen gelingt nämlich bis zum Ende nicht. Die Bausteine, die der Leser, Kapitel für Kapitel wie in einem Adventure-Spiel, fleißig, gebannt und manchmal mit Mühe einsammelt, ergeben am Schluss kein abgeschlossenes Gebäude. Für Klein ist die Kriminalgeschichte eine nicht dekodierte Parabel (darin beispielsweise Wladimir Sorokin und natürlich Kafka ähnlich) einer, sei es auf dem Kriegsfeld oder – der Vergleich liegt nahe – in Big Brother, kreatürlichen, fremdbestimmten und um ihr bloßes Überleben kämpfenden Menschheit, sowie Kulisse einer die Handlung ins Abseits verweisenden Sprache. Also geht der Autor traditionellem Erzählen nach und nach abhanden.
Mehr noch als bisher konkretisiert Klein das Geschehen historisch. Der "Steife Schnösel", das "fragliche[.] Bauwerk[.]" (in Hamburg), dient ihm als Verlängerung in die historischen Unzeiten, wo hinter der Fassade bundesrepublikanisch-gutmütiger Simplizität das Grauen weiter herrscht. Dass der kriminelle Revierfürst, Gabor Cziffra, aus ganz eigenen Interessen das Grab der vertriebenen jüdischen Familie Zucker als getürktes Mausoleum und die Stadt ebenfalls aus allem möglichen, nur nicht architektonisch-historischem Interesse dessen Kinopalast wieder aufbauen lässt, erscheint als skurrile Pointe einer sich stets wiederholenden Geschichte. Dabei bedarf es gar nicht dieser umfänglichen und sich fremd im so ahistorischen Textkörper ausnehmenden (architektur-)historischen Verweise, die die räumlich-zeitliche Einheit der Handlung aufweichen. Der geübte Leser wird sich Kleins Geschichtsbild auch so erlesen können.
Die gleiche Distanz, die zum Genre und zur Handlung aufgebaut wird, drückt sich in der artifiziellen und einzigartigen Sprache aus, die die Figuren Kleins benutzen. Sie unterscheidet sich nicht von Erzähler zu Erzähler, denn sie ist es, worum es eigentlich geht. Ihre Kraft bezieht sie aus wohlgeratenen detaillierten Beschreibungen und Bildern, aber auch aus übertriebenem Pathos, der Emphase, dem schwelgerischen Sich-Hingeben an die Höhen deutscher Rede. Da wird die "Mannschaft" schon einmal mit der Odysseus’ oder dem letzten Rettungsboot der Titanic verglichen. Boxfeld sagt am Ende über Vita: "Er gehöre zu den Opfern, die jedes große Projekt fordere. Fünfhundert Tote habe man dereinst beim Bau des Assuan-Staudamms beklagt." Diese Blümelei, die der jüngeren Verwendung des Kitsches folgt, führt wiederum zu einer ständigen Ironisierung, wenn zum Beispiel Cziffra die Funktion seiner "Nichte" Still folgendermaßen umschreibt: "Nun ist sie die Olive, die dunkel, glatt und fest auf einem Cocktail schwimmt, in dem sich Klarheit, Süße und reichlich Bitterstoff verbinden."
Die Faszinationskraft, die die Prosa Georg Kleins ausstrahlt, ergibt sich infolgedessen aus der Spannung zwischen fast asiatisch anmutender Bilddichte und der Düsternis, Verworfenheit und Offenheit des Plots. Manchen mag dieser Spagat überfordern, der einem traditionellerem Literaturbegriff anhängt. Nur: Wer vermisst bei einer solchen Sprachkunst noch die Kriminalgeschichte?