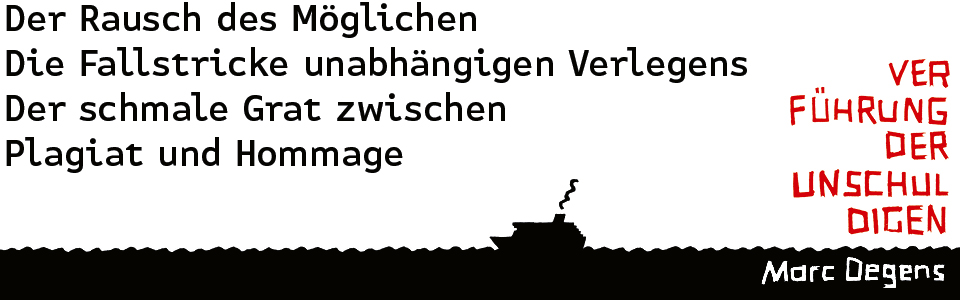
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
November 2007 | Marc Degens für satt.org |
|||
 |
Der SatansbratenDaß der Dichter Stefan George (1868-1933) homosexuell war und Knaben liebte, ahnte man seit Rainer Werner Fassbinders genialer Künstler- und Schriftstellergroteske „Satansbraten“. Und daß Stefan George ein geschickter Selbstvermarkter war, der sich sehr bewußt in der literarischen Öffentlichkeit in Szene setzte und sein Erscheinungsbild bis ins Kleinste (Schrift, Autorenfotos) kontrollierte, konnte man in dem vor zwei Jahren in der Reihe „Text+Kritik“ erschienenen Aufsatzband über „Stefan George“ (Band 168) nachlesen. Diese beiden Wesenszüge des Porträtierten strukturieren Thomas Karlaufs zu Recht gefeierte, in der F.A.Z. vorabgedruckte, über 800 Seiten starke Biographie „Stefan George. Die Entdeckung des Charisma“. Auch wenn manche Rezensenten glauben, daß über Stefan George noch längst nicht das letzte Wort gesprochen sein dürfte, so wird es künftigen Forschern zumindest schwerfallen, mit neuen Tatsachen aufzuwarten:
„Er trug einen Diamantring und ein goldnes Armkettchen, hasste Brillen, ließ sich beim Friseur rasieren und puderte sein Haar. Seine Lieblingsfarben waren mattes Blau und Gelb. Er hatte eine Aversion gegen bürgerliche Möbel und zog die funktionellen Gegenstände den repräsentativen vor: ein Stück Schuhsohlenleder als Schreibunterlage, ein Brotmesser als Brieföffner. Er besaß eine Briefmarkensammlung als Notgroschen für schlechte Zeiten, studierte gern Landkarten und war handwerklich geschickt. Er schnitzte mit dem Taschenmesser einen fehlenden Eierlöffel und bastelte aus Zeitungspapier und Strippe einen Ball für die Kinder. Er liebte es, auf einer Chaiselongue liegend zu reden, und hakte sich beim Gehen gern unter. Er reiste mit Spirituskocher, um sich immer seinen Tee aufgießen zu können, und begeisterte sich 1920 für mobile Taschentelefone.“ Es ist diese Detailliebe und -bessenheit, die Thomas Karlaufs Biographie so lebendig macht. Wer hätte gedacht, daß Stefan George aufgrund seiner Ablehnung Amerikas keine Ananas aß, daß er in früheren Jahren im Laufe eines Vormittags oft eine ganze Flasche Wein leerte und zeitlebens Dialekt sprach: „Wutz“ und „Hinkel“, „gemöcht“ und „schadt nix“ ... Das paßt so gar nicht zum Bild des dämonischen Dichterfürsten mit dem medusenhaften Blick aus den tiefen Augenhöhlen. Der einzige Vorwurf, den man Karlaufs Buch machen muß, ist, daß man nicht mehr über den Entwicklungsstand der mobilen Taschentelefone um 1920 erfährt. Als Schlüsselerlebnis in Georges Leben identifiziert Thomas Karlauf Stefan Georges frühes vergebliches poetisch-sexuelle Werben um den jungen Hugo von Hofmannsthal. Dieses Erlebnis prägte Georges weiteren Weg: „Lieber der Erste in den obskuren Kohlebergwerken Walloniens als im Paris Mallarmés ,einer der Unsrigen’. Nur da, wo er unangefochten an der Spitze stand, konnte sich Stefan George auf Dauer entfalten.“ Literatursoziologisch ist es besonders aufschlußreich zu lesen, wie George seine Karriere aufbaute, wie er sein Netzwerk spann und sich zunächst als fortschrittlicher europäischer Literaturvermittler präsentierte, der Anthologien herausgab und die Literaturzeitschrift „Blätter für die Kunst“ ... Und wie Stefan George dann, nachdem der Durchbruch geschafft war und er sich als Dichter etabliert hatte, plötzlich jegliches Interesse an der zeitgenössischen Dichtung verlor und seinen Messianismus fortan auf das eigene Werk und die eigene Person fokussierte. Diese Entwicklung läßt sich bis heute in vielen Künstlerkarrieren nachweisen.
Dementsprechend findet in Thomas Karlaufs Biographie nach gut einem Drittel eine Akzentverschiebung statt – das Augenmerk richtet sich von da an weniger auf Georges Dichtung, als vielmehr auf seine Anhänger und die Strukturen innerhalb des von dem Dichter streng, mitunter sogar grausam regierten „George-Kreises“. Tatsächlich lassen sich seine späten rätselhaften Verse ja auch in der Mehrzahl als persönliche Mitteilungen des an Politik nicht interessierten „Führers“ an seine „Jünger“ deuten, zu denen Claus Graf Schenk von Stauffenberg, der vor 100 Jahren geborene Hitler-Attentäter und einer von Georges Lieblingszöglingen zählte. Die Künstlerbiographie wechselt zu einer spannenden historischen Studie, so wie sich Sebastian Haffner das wünschte, als er ausdrücklich ein „Kapitel deutscher Geistesgeschichte, das ,George – Hitler – Stauffenberg’ heißt“, forderte. Mit seinem Buch hat Thomas Karlauf einen wichtigen Anteil zu diesem Kapitel geliefert. Doch das Ergebnis fällt wahrscheinlich ganz anders aus, als es Sebastian Haffner erwartete: „Der Stern des Bundes [Gedichtband von Stefan George, erschienen 1914] war der ungeheuerliche Versuch, die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten geistigen Daseinsform zu erklären. Wer dies nicht sah oder nicht sehen wollte, musste die tausend Verse für inkommensurabel halten.“ Das Päderastie, die Abhängigkeit, das Verstoßen der Anhänger und die zahlreichen Selbstmorde ... All dies thematisiert Thomas Karlauf in dem Buch, trotzdem ist seine Biographie keine Skandalchronik, die den Dichter und seine Mitglieder bloßstellen will. Für einen so intimen George-Kenner wie Thomas Karlauf wäre es ein leichtes gewesen, die Sensationsgier der Leser mit schlüpfrigen Enthüllungen und unappetitlichen Einzelheiten zu stillen, aber Thomas Karlauf interessiert weniger das „Wie“, als das „Wieso“. Um die Abhängigkeiten von George und seiner Gefolgschaft zu erklären und die Strukturen innerhalb des Kreises abzubilden, arbeitet Thomas Karlauf äußerst erfolgreich mit Max Webers Begriff der charismatischen Herrschaft. Die Analyse funktioniert hervorragend, was auch ein weiteres Indiz für die von Thomas Karlauf getätigte These ist, daß Max Weber seinen Herrschaftsbegriff durch die Analyse des „George-Kreises“ gewann. Thomas Karlauf will Stefan George mit seinem Buch weder verteidigen noch verteufeln. Die Studie besticht durch sprachliche Eleganz und der geschmackssicheren literarischen Urteilsfähigkeit des Autors. Thomas Karlauf weist auch auf sonderbare künstlerischen Widersprüche in dem Werk des Dichters hin, zum Beispiel bei der Gestaltung der Gedichtbände, die zwischen einer modernen, sachlichen, äußerst sparsamen und kühlen Gestaltung und einer anachronistischen preziösen Ausschmückung wechselte. Obwohl Thomas Karlauf ganze Werkgruppen und Gedichtbände verdientermaßen aburteilt („Sieh hier den becher golds/Voll von funkelndem wein –/Jedes hat einen Schlurf!“) und damit seine Unabhängigkeit unter Beweis stellt, weist er ebenso immer wieder auf äußerst schöne, teilweise sogar moderne Verse und Gedichte hin, Zeilen wie diese: Mild und trüb So ruft Karlaufs Biographie auch den Ausnahmedichter Stefan George in Erinnerung, der angesichts des „Menschenfischers“ und „Satansbratens“ oft vergessen wird. Weiterführende Links: |
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |

