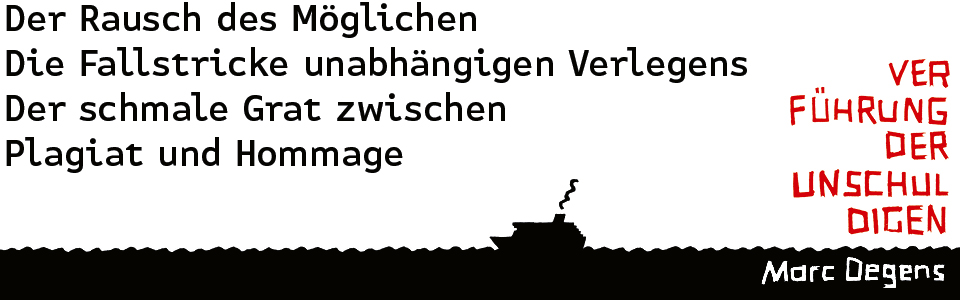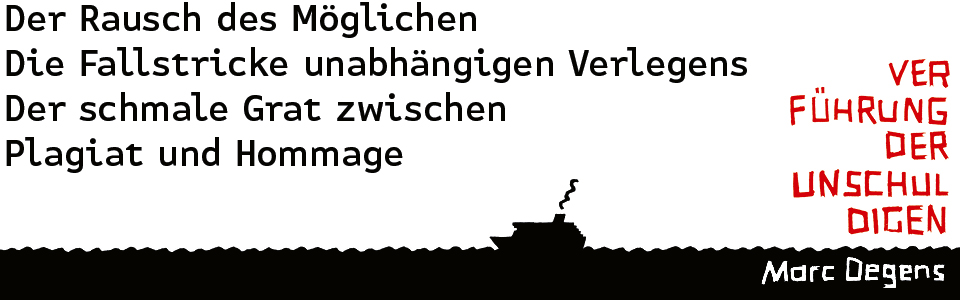| |
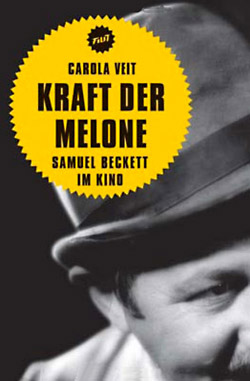
Carola Veit: Kraft der Melone.
Samuel Beckett im Kino
Verbrecher Verlag, Berlin 2009
Broschur, 80 S., 11 Euro
» Verbrecher
» amazon
|
Kraft der Melone
Samuel Beckett im Kino
Das Buch von Carola Veit erscheint in der Reihe "Filit", die der Berliner Verlag herausbringt und die die Parallelen zwischen Literatur und Film untersucht. Die Verfasserin des Buchs arbeitet bereits seit mehreren Jahren zu Samuel Becketts Werk, ihre Promotion behandelte ihn ebenso wie auch eine von ihr kuratierte Ausstellung im Jahr 2006 im Literaturhaus Berlin.
Beckett besuchte in den Jahren 1936 und 1937 das Deutsche Reich und schaute sich zahlreiche zeitgenössische Filme an. Die entsprechenden Tagebücher sind bis heute nicht oder nur in wenigen Fragmenten veröffentlicht, doch Veit hat Einblick in die Aufzeichnungen nehmen können: „Die während der Reise geführten, bis auf den Hamburg-Teil unveröffentlichten Tagebücher umfassen sechs Notizhefte, eng beschrieben mit persönlichen Beobachtungen, Notizen zu persönlichen Begegnungen und Hunderten von Gemälden, die er in Museen angesehen hat, einigen Konzerten, wenigen Theateraufführungen und sechzehn Spielfilmen. Bei der Filmauswahl ist er keinen bestimmten Kriterien gefolgt, nur dem, dass er ausschließlich aktuelle Filme angesehen hat, deren Uraufführung in Deutschland höchstens ein halbes Jahr zurücklag.“
Interessant ist sicher die Tatsache, daß sich Beckett vor seiner Deutschlandreise beim russischen Regisseur Sergej Eisenstein um eine Aufnahme an der Moskauer Staatlichen Hochschule für Filmkunst bewarb. Zudem nehmen die Beschränkungen des Kulturlebens in Mitteleuropa rasant zu, in Spanien bricht ein Bürgerkrieg aus, Becketts Mutter drängt ihn zu einer seriösen beruflichen Karriere. In dieser Zeit lernt Beckett in Deutschland einige Filmschauspieler kennen und bildet sich anhand zahlreicher Kinobesuche eine Meinung zur Filmkunst des Dritten Reichs. Summa summarum fällt Becketts Urteil nicht sonderlich gut aus: manche der Filme befänden sich entweder vom Inhalt oder von der Form „beneath criticism.“
Die deutschen Synchronisationen von amerikanischen Kassenschlagern wie „Die Meuterei auf der Bounty“ oder „San Franzisko“ befinden sich auch unter den besuchten Filmen. Zu jener Zeit wurden US-amerikanische Filme im Deutschen Reich noch oft gezeigt. Beckett achtet bei seinen Kinobesuchen penibel auf die technische Ausführung der Filme. Das zeigt sich deutlich in Tagebucheintragungen wie „E. acts well + the film is quite amusing, though rather badly directed + cut" (zu „Der lachende Dritte“ von 1936, Regie: Georg Zoch) oder „film best I have yet seen of Ufa’s latest, quite well acted, + directed, rather obviously but inoffensively cut, in part excellently photographed“ (zu „Wenn wir alle Engel wären“ von 1936, Regie: Carl Froelich).
Während seiner Kinobesuche formt sich bei Beckett ein eigenes filmographisches Verständnis. Es fällt auf, daß ihm vor allem Rollen, die sich auf das Wesentliche reduzieren, beeindrucken („At 7 go to see Krauss in Burg Theater in a little Kino in Kantstrasse. Admirable performance. Good film. He is the best actor I have seen. Restraint. What a style“). Die Reduktion wird sich auch in späteren Werken von ihm niederschlagen, wie Carola Veit in einem begleitenden Essay ausführt. Besonders der Stummfilm kommt Becketts Vorliebe für unpathetische Schauspielerei und Reduktion zupaß: „In diesem Sinn der Unmittelbarkeit der Darstellung mag Beckett insbesondere der Stummfilm begeistert haben, vor allem, nachdem dieser sich vom bloßen Abfilmen eines theaterhaften Geschehens in der Frühzeit gelöst hatte und seine eigenen Mittel wie Kameraeinstellung und Schnitt erforschte. Hier fand sich visueller Eindruck jenseits der Sprache, allein durch Gestik, Mimik und Szenenverkettungen.“