
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
28. März 2010 | Martin Jankowski für satt.org |
 | 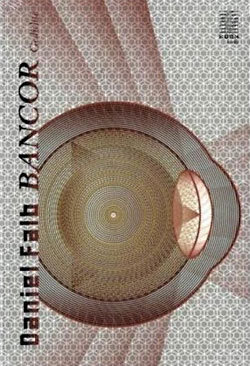 Experimente am SprachrandVor sieben Jahren machte der Berliner Lyriker Daniel Falb (Jahrgang 1977) mit seinem Debütband „Die Räumung dieser Parks“ (kookbooks 2003) auf sich aufmerksam und erntete viel Applaus bei Publikum und Kritik. Nun liegt mit „Bancor“ sein zweiter Band vor, erneut in brillanter grafischer Gestaltung von Andreas Töpfer. Die neuen Gedichte tragen keine Überschriften, strukturiert werden sie allein durch formell unspektakuläre Folgen einzelner Sätze, die durch Leerzeilen verbunden sind. Aber diese Sätze haben es in sich. „geburtstag, das ist ein loch in der erde, aus dem die hummeln zur nahrungssuche hervorströmen.“ Gegliedert in drei Kapitel erwarten uns Wortgeflechte, die weder von den üblichen Formen aus Metaphern, Strophen, Zeilenbrüchen, lyrischem Ich usw. geprägt sind, noch einfache Angebote machen. Textmonaden überlassen uns der Wucht ihrer Wörter: Klanglich geschmeidige, inhaltlich oft hybride Sätze, die gängige Sprachmuster collagenartig miteinander verknüpfen und eine Flut von Bildszenen erzeugen. Die übliche „neue Lyrik“ ist das schon mal nicht. Die Dichte der Texte ist eine Herausforderung an den Leser. Aber es gibt viel zu entdecken: Verblüffendes, Überraschendes, Spielerisches. Der studierte Philosoph Falb hinterfragt die großen Ideen der Menschheit mit den subversiven Registern heutiger Sprache. Der Titel „Bancor“ signalisiert, worum die meisten Texte des Buchs kreisen: Es geht um gesellschaftliche Muster, um sprachliche und soziale Konventionen und ihren beständigen Wandel. „bald war alles übersät mit resolutionen, in deren weichbild man eintrat, den geltungsbereich eines dialekts oder singvogels.“ Bancor war die Bezeichnung für eine 1944 von John Maynard Keynes vorgeschlagene Weltwährung, eine Verrechnungseinheit für den internationalen Bankverkehr, die niemals realisiert wurde. Falb gefiel, wie er sagt, der besondere Klang des Wortes, deshalb wählte er es als Leitwort seines Schreibens. „Das Geschäft des Schreibens lyrischer Texte hat mit Sehnsucht — wonach auch immer — nun wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern einzig allein mit der Konstruktion ästhetischer Objekte“ gibt er im Magazin „BELLA triste“ (Nr. 25, Herbst 2009) über seine Schreibhaltung Auskunft: „Es ist grundsätzlich möglich, den Text als ... Ausstellung von Wörtern zu verstehen ... Es reicht nicht, wenn der Text interessant ist in dem, was er sagt (Thesen, Meinungen, Haltungen etc.) — sondern er muss interessant sein in dem, was er tut und ist.“ „der elektromagnetische staat reicht bis an die tropopause.“ Falbs Bezüge sind wissenschaftliche, politische und philosophische Debatten, bildende Kunstwerke und literarische Texte, im Anhang findet man ein Verzeichnis der Quellen seiner Inspiration für die einzelnen Texte. Intertextualität ist kein Merkmal, sondern selbstverständliche Voraussetzung dieser doppelbödigen, nicht selten atemberaubenden Texte, die auch beim x-ten Lesen nichts von ihrer ursprünglichen Energie verlieren. Man muss sich allerdings aktiv mit ihnen vertraut machen, damit die dynamischen Kontraste des Denkens spürbar werden, die unterm scheinbar unverbindlich glatten Klang verborgen liegen. „wir kontrollierten die, die uns beobachteten, indem wir genau das machten, was sie sahen.“ Wenn die Musikkritik die „Hamburger Schule“ wegen ihrer alltagsphilosophischen Songtexte als „Diskurspop“ bezeichnet, könnte man Falbs Lyrik analog dazu Diskurslyrik nennen. Er experimentiert an den Rändern dessen, was Lyrik vermag. Provokant testet er lyrische Verfahren, ohne neue Worte zu erfinden oder Metren zu bemühen, durch semantische Collagen und Kombination verschiedenster Diskursformen, durch permanente Cut-ups aktueller Slangs und sprachlicher Millieus: Fragen, Behauptungen und Aphorismen, die sich thematisch gegenseitig annähern, sich gekonnt ins Wort oder in die Arme fallen, wo ein einziger Gedanke zum Thema nicht genügen kann. Denn dass ein einziger Gedanke selten genügt, dass immer auch ein aber, eine Brechung, eine andere Seite mitgedacht werden muss, ist ja kein Problem von Falbs Texten, sondern der Lyrik, der Literatur mittlerweile insgesamt. „foyers oder lobbys, in denen die zahlungsbereitschaft für ein einfaches glas wasser beständig steigt.“ Der Literaturkritiker Michael Braun vermisst in einer eher argwöhnischen Besprechung („Kühler Mischer der Diskurse“, Tagespiegel, 18.10. 2009) in Falbs Texten das lyrische Ich und diagnostiziert nichts als „eine poetische Relaisstation ... in der keine Gefühle mehr zählen, sondern einzig noch das beiläufige Registrieren von Sprachbewegungen“. Das ist angesichts der einander regelrecht ins Wort fallenden Gefühlsströme in Falbs Texten eine höchst erstaunliche Einschätzung. „im lehrbuch dessen, was wir zu sagen hatten, führte ein träger freundlicher emotionen zum ziel, der eingebaute kleine freund“ Statt des romantisch-empfindsamen Ichs findet sich in Falbs Texten ein abgeklärtes, im Multitasking des 21. Jahrhunderts geübtes. Vor allem aber spricht bei ihm zumeist ein affirmativ großes wir, gewissermaßen das „lyrische Wir“ gesellschaftlichen Kommunizierens – eine der Grundhaltung der Texte entsprechende, überzeugende lyrische Perspektive. Der dritte Teil des Bandes, „Magna Charta“ überschrieben, macht Falbs Anliegen besonders deutlich: Orientiert an Rhythmus und Sprache der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ untersuchen seine Gedichte die Wirksamkeit solcher „Menschheitstexte“ und schneiden sie gegen die Alltagssprache des interaktiven Medienzeitalters. Falbs neue Gedichte verlangen viel und wagen Ungewöhnliches. Wer das mag, sollte sie unbedingt lesen. „die allgemeinheit überlegt noch, wer für sie siegen darf.“
Daniel Falb: Bancor |
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |