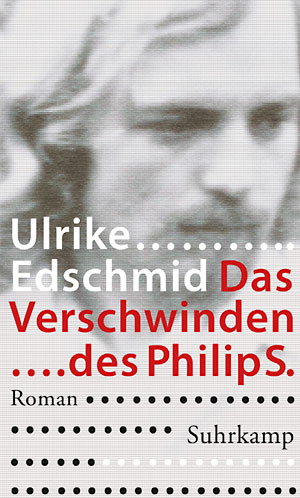| |
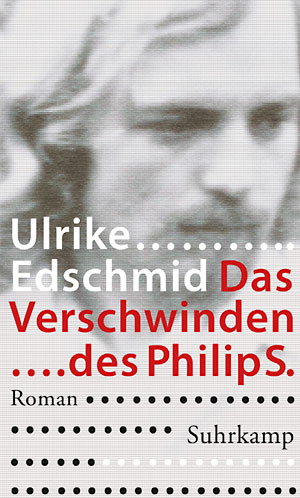
Ulrike Edschmid, Das Verschwinden des Philip S.
158 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 15,95 Euro
» Verlag
» amazon
|
Vorsicht Schußwaffen!
Das Verschwinden des Philip S.
von Ulrike Edschmid
Der Terror der RAF war in meiner Kindheit stets präsent, die Phantome wandelten unter uns, das war normal. Im Biergarten der Ettaler Mühle zum Beispiel, wo wir im Sommer manchmal hinfuhren, da saßen die Erwachsenen auf ihren Bierbänken, der Koch stand am Grill und wendete die Fische, wir Kinder spielten am idyllisch dahinplätschernden Bach, in dem sich nutzlos, nur zur Staffage, das alte Mühlrad drehte, und daneben hing ganz selbstverständlich das rot umrandete Plakat mit den unscharfen Schwarzweißgesichtern: „Terroristen. Vorsicht Schußwaffen!“
Eines Morgens berichtete der Münchner Merkur auf seiner Titelseite von einem nur knapp gescheiterten Attentat auf die NATO-Schule in Oberammergau, meinem Heimatdorf. Das mit Sprengstoff vollgepackte Auto war in letzter Sekunde entdeckt, die Bombe entschärft worden. Die Täter wurden nicht gefasst.
Das war natürlich für die nächsten Wochen das Thema im Dorf. Jeder hatte die Terroristen gesehen, jedem war etwas merkwürdig vorgekommen an diesen Fremden, die monatelang eine konspirative Wohnung in unserem Alpendörflein unterhalten hatten.
Jahre später entwickelte ich erneut eine Faszination für den Terror. Ich verschlang den Baader-Meinhof-Komplex von Stefan Aust und daran anschließend noch alle anderen einschlägigen Bücher, derer ich habhaft werden konnte. Es gab damals noch nicht so viel Literatur zu dem Thema wie heute, die RAF war Anfang der Neunziger noch nicht Geschichte.
In der 12. Klasse schrieb ich meine Facharbeit über das Thema „Die Entstehung der RAF und die Reaktion des Staates“. Meine These war so ungefähr, dass der Staat von Anfang an auf die Bedrohung von Links völlig überreagiert und sich dadurch den zunächst ja eher harmlosen Linksaktivisten als genau das faschistisch-gewalttätige Willkürmonster offenbart habe, das sie in ihren marxistischen Pamphleten an die Wand gemalt hatten – ein Monster, dessen ebenso gewalttätige Bekämpfung ihnen nun umso gerechtfertigter erschien: Startpunkt einer Spirale der Gewalt, deren weitere Eskalation spätestens mit dem Abtauchen der RAF-Leute in den Untergrund durch keinen Dialog mehr habe abgebremst werden können.
Keine besonders waghalsige oder neue These, aber immerhin auch nicht ganz falsch, wie mir heute noch scheint.
Ich musste an all das wieder denken, als ich neulich auf einer längeren Zugfahrt den Roman Das Verschwinden des Philip S. von Ulrike Edschmid las, der mir meine Facharbeitsthese geradezu exemplarisch zu belegen schien.
Das Buch beschreibt aus der Perspektive seiner damaligen Lebensgefährtin, der namenlosen Ich-Erzählerin, den Weg des Filmstudenten Philip S. in den Untergrund. Sie schildert S., der 1967 nach Berlin kommt, um dort an der Filmakademie zu studieren: S., ein sensibler, einfühlsamer Mensch, in der Filmarbeit ein perfektionistischer Ästhet. Von den Kommilitonen wird sein erster Film als unpolitisch und formalistisch abgelehnt. Die Vorwürfe prallen an ihm ab:
„Er hat gezeigt, wohin er mit seinem Film gehört. Er hat Menschen dargestellt, deren Vereinzelung, Einsamkeit und Verstrickung in undurchschaubare und bedrohliche Mächte metaphysischer Art ist und durch keine Revolution aufgehoben werden kann.“
Als im Frühjahr 1968 Schüsse auf einen Studentenführer abgefeuert werden und das Parlament Ausnahmegesetze für den Notstand erlässt, fühlt sich Philip S. mehr und mehr zum Widerstand aufgerufen, besucht studentische Versammlungen und Demonstrationen, macht mit bei der Besetzung der Filmhochschule.
Parallell zu diesen öffentlichen Ereignissen, bleibt er im Privaten eigentlich ganz unverändert. Dem Sohn der Erzählerin, der nicht der seine ist, ist er ein liebevoller Vater. Er engagiert sich in den selbstorganisierten Kinderläden, die gegen das staatliche Erziehungsmonopol gegründet werden.
Doch wegen seines Engagements in linken Kreisen steht das Paar bald unter Beobachtung der Polizei, immer, wenn es irgendwo knallt, steht sie vor der Tür. Plötzlich gibt es kein Privates mehr. Als Philip S. und seine Gefährtin über Wochen unter falschem Verdacht in Untersuchungshaft festgehalten werden, kommen sie als veränderte und einander entfremdete Menschen wieder heraus:
„Wir sind nicht an den gleichen Ort zurückgekehrt, nicht in das gleiche Leben. Aber das wissen wir noch nicht. Erst später sehe ich deutlich, wie in dem, was damals geschah, schon das Zukünftige aufschien. Unter der Hand veränderte sich etwas, das ich im Rückblick als Zeitwende begreife, das Leben spaltete sich auf in die Zeit vor dem Gefängnis und in die danach.“
S., der sich vom Staat offen verfolgt sieht, bereitet jetzt alles für das Leben im Untergrund vor, vernichtet Fotos, fälscht Pässe, trifft sich mit Leuten, die bereits abgetaucht sind. Die Erzählerin hingegen will gegen alle Widerstände ein eigenes Leben in Legalität führen, will auch ihr Kind nicht verlassen.
Die Liebe zerbricht.
Das ist ziemlich erschütternd zu lesen, gerade weil es völlig unsentimental erzählt ist.
Am Ende stirbt Philip S. auf einem Parkplatz im Kugelhagel der Polizei, und das ist sein endgültiges Verschwinden, das die einstige und, wie man beim Lesen zu spüren glaubt, ihm über den Tod hinaus verbundene, Gefährtin dokumentiert.
Im Zug sitzend, las ich das schmale Buch durch, ohne einmal abzusetzen, und als ich es schließlich zuklappte und nachdenklich dieses seltsame Deutschland an mir vorübersausen sah, da kamen mir meine Kindheitserinnerungen wieder in den Sinn.
Auf dem Platz neben mir hatte die ganze Zeit ein uniformierter Polizist gesessen, der hauptsächlich mit seinem Handy beschäftigt gewesen war und jetzt an der Haltestelle Jena Paradies den Zug verließ. Nicht unbedingt ein Freund und Helfer, aber auch kein Repräsentant eines Schweinesystems, dachte ich, nachdem wir uns lächelnd voneinander verabschiedet hatten. Ein ganz normaler Mitreisender, wie alle anderen auch.