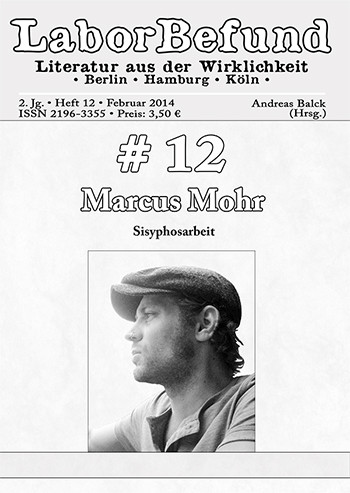| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
17. Mai 2014 | Johannes Witek für satt.org |
|||

|
Sisyphosarbeit„It appears that certain people think that poetry should be a certain way. For these, there will be nothing but troubled years. More and more people will come along to break their concepts. It's hard, I know, like having somebody to fuck your wife while you are at work, but life, as they say, goes on.“ Jo Baby, Social Beat. Der Alk, die Kippen, Nutten, Drogen, Hartz 4, bevor es überhaupt Hartz 4 gab! Die Miete fällig, die Frau weg, der Kater da, der Großstadtdschungel: die ungeschönte Realität. Die Härte des Lebens am unteren Rand der Gesellschaft, am Rand überhaupt. Wo sonst? Nur Arschlöcher überall. In den Neunzigern entstand in Deutschland eine Literatur, die, inspiriert durch die amerikanischen Vorbilder der Beats und vor allem Charles Bukowski, eine authentische ungeschönte geradlinige Lyrik von unten zum Ziel hatte. Eine wichtige und dringend benötigte Gegenbewegung zum vielzitierten Primat der weinerlichen Innerlichkeit der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und insbesondere zum hermetisch abgeriegelten, postmodern luftundurchlässigen, komplett humorfrei versiegelt und zu Tode fragmentierten Sprachkorpus der deutschsprachigen Lyrik. Die Fronten waren klar: Auf der einen Seite der Blues der Bartresen und U-Bahnschächte und Neonröhren und Schuhsohlen auf dreckigem Beton – das Leben verschissen in sinnlosen Jobs, die einen körperlich und psychisch killen, kein Geld, keine Chance, keine Perspektive – dafür so was wie Humor und der allgegenwärtige Mittelfinger gegen die Gesellschaft, den Arbeitgeber, den Vermieter, das Sozialamt. Die Art von Stil, die einen am Boden in der eigenen Kotze liegend über sich selbst lachen lässt, weil das alles ist, was einem bleibt. Das Bedürfnis, dafür eine Sprache zu finden, ein Ausdrucksmittel; Poesie, gerade und schnörkellos wie eine Faust ins Gesicht, ein Tritt in die Eier, ein gepflegter Furz in einem überfüllten Fahrstuhl. Auf der anderen Seite: Durs Grünbein. Oder seine Lyrik. Oder beides, falls die sich zufällig im selben Raum aufhalten. Die Akademie, das Elfenbein, die Thomas Mann-Gesellschaft. Der Leonce und Lena-Preis, der Literarische März, Neo-Formalismus, postpostmoderne Neufindung von Naturlyrik, Buchhandlungen und Literaturhäuser um vier Uhr nachmittags, Mineralwasser, die Nische des Literaturbetriebs als subventionierter Selbstläufer, in dem das Produkt Literatur eigentlich nur noch bloße Alibifunktion zur Erhaltung des Kulturbonzenstatus hat; Berlin, Leipzig, Wien, Schreibschulen, Literaturinstitute, bräsige öde Befindlichkeitsprosa von wohlstandsgenährten jungen Menschen mit Hipsterbärten, Retrobrillen und MacBooks Pro; Literaturtheorien, Lyriktheorien, und alles im Bett bei Anbruch der Dunkelheit mit den Händen über der Bettdecke. Beide Seiten haben ihre Klischees, beide Seiten haben ihre Probleme. Beide sind naturgemäß unvereinbar und funktionieren prinzipiell nur in der Abgrenzung voneinander. Ein Problem der Social Beat-Fraktion war, dass die Vorbilder überlebensgroß sind. Von Céline und Henry Miller, die natürlich auch ihre Vorgänger und Einflüsse hatten, über die Beats mit Burroughs zu Bukowski und Hunter S. Thompson in den deutschsprachigen Raum – die Bombe zündet, der Impact tritt ein, die Schockwellenreiter schwingen sich auf ihre Bretter: Brinkmann, Fauser, Wondratschek, auch Nicolas Born, der unlängst verstorbene Hadayatullah Hübsch, Gasolin 23, Jürgen Ploog, Carl Weissner, you name it. Initialzündung in den Siebzigern, Flaute in den Achtzigern, in den Neunzigern dann Social Beat. Zur Jahrtausendwende auch schon wieder Schluss mit dem Hype und was bleibt uns jetzt? Poetry Slams und medientaugliche Bestseller-Fressen bei der Buchmesse? Schräge und weltfremde Büchnerpreisträgerinnen wie Sibylle Lewitscharoff? Der Berlin-Roman? Arschkrebs? Die Beats und Bukowski, Henry Miller, Hunter S. Thompson, Céline, auch Hemingway, soweit er in der Beziehung eine Rolle spielt, sind jedenfalls epochemachende Naturgewalten, deren inspirative Kraft unweigerlich mit ewig epigonalem Kräulen im Schatten der überlebensgroßen Vorbilder einhergeht. Wer darin nicht versacken will, muss genug Eigenes mitbringen, um nicht als Kopie zu versanden. Originalität. Und, hier kommt ein dreckiges Wort: Talent. Fast Forward ins Jahr 2014. Marcus Mohr ist Kölner, Baujahr 81 und Herausgeber der Zeitschrift Straßenfeger, die seit 2003 in unregelmäßigen Abständen unregelmäßige Poesie in die Welt pumpt. LaborBefund - Literatur aus der Wirklichkeit ist eine Literaturzeitschrift, die seit 2013 genau das tut, was sie sich im Titel zum Programm macht: Sie pumpt Literatur in die Welt. Ungeschönte, gerade und schnörkellose Literatur „aus der Wirklichkeit“. Nach Autorenheften von verdienstvollen Veteranen des Guten, Wahren & Schönen wie Hermann Borgerding (# 7) und Jerk Götterwind (# 11) ist jetzt am 21.2.2014 LaborBefund # 12 - Marcus Mohr: Sisyphosarbeit erschienen. Das Heft hat 40 Seiten und enthält, neben einem Vorwort von Ni Gudix, dreiundzwanzig Gedichte von Marcus Mohr. Diesen Gedichten, wie dem gesamten Mohr'schen Œuvre, ist gemein, dass sie Humor, Emotionen und die Verteidigung des „Ich“ gegen eine Welt, die einem überwiegend an den Arsch und an die Kehle will, mit der Eleganz und Subtilität eines anständig alkoholhältigen Harnstrahls gegen eine bunt dekorierte Schaufensterscheibe kombinieren. Hier wird gerotzt, gepisst, getrunken, geraucht, geklaut, gelaufen, getreten, gelacht, gewartet, ein wenig gehofft, gelebt, gesucht und gefunden – all die dreckigen Wörter. Marcus Mohr findet Zärtlichkeit zu seiner Frau wo sie auch ist, nämlich zwischen Fürzen, ungewaschenen Füßen und RTL II („Wie ein Gedicht“), sackt in eruptiver Sprache vorbildlich durch Nächte und Betten („Blick in die Tiefe aus Sicht eines Bullauges“), randaliert und erregt öffentlich Ärgernis wie jeder anständige Dichter nach Kneipenschluss („Blaupause“), findet eine metaphysische Kindheitsimpression invertiert im Spätkapitalismus bestätigt (war das jetzt ein schöner Satz, oder was?! – aber stimmt, lest das Gedicht, es heißt „Moderne Sekten“), und, natürlich, das Verhältnis zu den Frauen: schwierig. Melden sich nicht und machen man-will-lieber-gar-nicht-wissen-was („Sie ruft nicht an“), gehen überhaupt gleich für immer („Kreidezeit“), machen einen grundsätzlich balla („Am Beispiel einer Fabel“), können den subtilen Humor darin nicht entdecken, im Schlaf mit wasserfestem Edding bemalt zu werden („Rollentausch“), und in drei Stunden in einer Schwulenkneipe bekommt man mehr Komplimente von Typen als in drei Jahren von den Mädels („Beim schwulen Mattes“). Man hats nicht leicht, als heterosexueller Mann nach der Jahrtausendwende. Texte wie „Schlaflos in Kölle“, „Neoblues Vol. 1“, „Mit Bleifuß aufm Bodenblech“ und „Lebenswert“ gehören zu dem Besten, was das Genre „Literatur aus der Wirklichkeit“ zu bieten hat. Sie funktionieren auf sämtlichen Ebenen, als Vertreter des Genres insofern, als hier das Individuum Bilanz zieht über sich und das Leben, diese Bilanz dann mit der Geradlinigkeit eines fliegenden Pflastersteins den Leserinnen und Lesern ins Gesicht befördert, ohne dabei Humor, Selbstironie und Emotionen zu vergessen, und letztlich über die Sprache selbst. Genrebedingte Punchlines am Ende der Gedichte inklusive, finden sich hier Sätze, Formulierungen und Mohr'sche Klassiker, die nach der Lektüre noch lange nachbrennen: „mit der Realität, Jede Literatur, die sich „Realität“ und „Authentizität“ zum Programm macht, muss sich naturgemäß an diesem Anspruch messen lassen. Nachdem die Frage, was diese Begriffe überhaupt sein sollen, eine ungelöste ist und die Diskussionen dazu endlos, empfiehlt sich weniger die Suche nach „wahren Begebenheiten“ hinter den Texten, sondern eher ein Blick auf das Ganze. Der Wirklichkeitsanspruch dieser Texte begründet sich in dem Bestreben, ohne Schnörkel, ohne allzu viel Geschwurbel und blutleerer Innerlichkeit als Sprachrohr und Reaktion des Individuums auf seine jeweiligen Lebensumstände zu funktionieren. In diesem Sinn kann auch das Konzept „Literatur aus der Wirklichkeit“ als Fortsetzung und konstante Weiterentwicklung des Social Beat-Imprints der späten Neunziger und damit als Beschäftigung mit dem ursprünglichen Beats-Burroughs-Bukowski-Impact der Siebziger im deutschsprachigen Raum im Jahr 2014 verstanden werden. Nicht als Abklatsch oder Kopie oder Epigonentum, sondern, wie bei den Gedichten von Marcus Mohr, als – im besten Fall – konstante eigenständige Weiterentwicklung einer der wenigen, wenn nicht der einzigen realen Alternative zum gegenwärtigen deutschsprachigen Literaturbetrieb. Denn im Grunde ist diese Abgrenzung mit all ihren zusammengetackerten Fanzines, alternativen Kleinverlagen, alkoholgetränkten Lesebühnen und von reinen Idealisten zusammengeklaubten Anthologien eine Hommage an die Literatur selbst: Nach wie vor gibt es Stoff, Motive, Themen, den nötigen Schmerz, die Sehnsucht, die Verzweiflung und das Bedürfnis, sich auszudrücken – nach wie vor muss dafür erst eine eigene Sprache, ein Genre, eine Kunstform abseits der etablierten Literatur gefunden werden. Dazu MUSS man nicht auf dem Bau arbeiten, Alkoholiker sein, auf Polizeifahrzeuge urinieren, Schaufenster einschlagen oder in U-Bahnhöfen übernachten. Es schadet nicht, aber im Grunde muss man überhaupt nur eines: So wenig Bullshit wie möglich erzählen und sich nicht zu etwas machen, das man nicht ist. Natürlich haben der geneigte Leser und die geneigte Leserin nach Lektüre dieser Gedichte keine Garantie dafür, dass es sich bei Marcus Mohr nicht um einen VWL-Studenten im 7. Semester handelt, der in pinkem Polo-Shirt mit hochgestelltem Kragen und sauber gespitztem Bleistift diese Verse an einem sonnengefluteten Sonntagnachmittag zu Papier gebracht hat, während sein Auto durch die Anlage läuft und die Zukunft rosa in den Kamillentee grinst. Falls diesbezüglich Fragen bestehen, empfehle ich, Herrn Mohr einen langen, langen Brief zu schreiben und sich schon mal auf seine Antwort zu freuen. Ich möchte diese meine Kritik wie folgt zusammenfassen und mit einer Empfehlung enden, die, wie ich annehme, auch im Sinne des Autors ist: Geiler Scheiß! Kaufen, lesen, Kölsch kippen!
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |