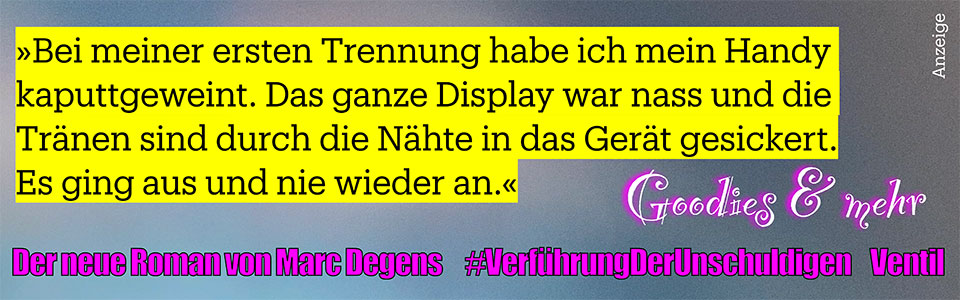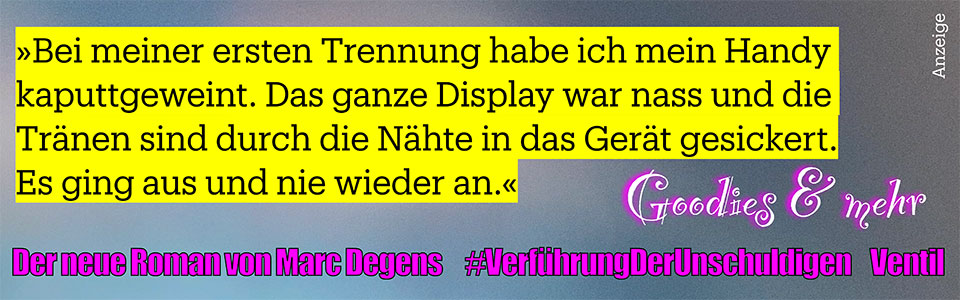Mute Audio Documents 1978 - 1984
Mute Audio Documents
1978 - 1984
Boxset
Mute/EMI 2007

» amazon
|
Wir schreiben das Jahr 1977: der 26jährige Daniel Miller, großer Fan deutscher Elektronik- und Krautrockbands wie Can und Kraftwerk, kauft sich für 150 Britische Pfund einen gebrauchten Korg-Synthesizer und nimmt in seinem Nordlondoner Schlafzimmer die Single “Warm Leatherette/TVOD” auf. Er tauft sein Ein-Mann-Projekt The Normal und lässt auf eigene Kosten ein paar Kopien pressen. Auf die Rückseite des Covers schreibt er “Mute Records” und seine Privatadresse. Miller fasst sich ein Herz und bietet die Single dem Rough-Trade-Laden um die Ecke an. Geoff Travis ist angetan vom stakkatoartigen Rhythmus, dem hypnotischen Sound und dem grausigen Text (“Warm Leatherette” lehnt sich an J.G. Ballards Geschichte “Crash” an, in der es um einen Typen geht, der von Autounfällen sexuell erregt wird) und rät Miller, gleich 2000 Stück zu produzieren. Die Sounds-Journalistin Jane Suck ist begeistert von “Warm Leatherette” und ernennt die Platte zur “Single of the Century”. Die Erfolgsgeschichte von Mute Records beginnt. Ein Label ist geboren, das zusammen mit Rough Trade und Factory Records sinnbildlich für die Independent-Bewegung und DIY-Ethos steht. Zeitgleich mit “Warm Leatherette” erscheinen erste Elektro- und Industrialplatten von Throbbing Gristle, Cabaret Voltaire, The Human League – nicht nur für Miller scheint rein elektronisch produzierte Musik die einzige logische Weiterentwicklung nach Punk zu sein. Punkrock hatte sich 1978 bereits totgelaufen, nach den Sex Pistols, The Clash und The Damned sprangen viele weniger begabte Bands auf den Punkzug auf und spielten im Grunde nichts anderes als schnellen Rock'n'Roll oder Pubrock, sprich, die Revolution begann zu verpuffen, die Akteure wurden aus den verschiedensten Gründen unglaubwürdig, die Gitarre wurde verdächtig. Was passte besser in die Zeit als der “künstliche” Klang technischer Geräte wie dem legendären Korg-Synthesizer? Neben Daniel Miller und den oben genannten Bands begannen viele Musiker, mit Synthesizern zu experimentieren, zum Beispiel Frank Tovey, der unter seinem Projektnamen Fad Gadget Daniel Millers erstes Mute-Signing wurde. Zu Fad Gadget gesellten sich bald die Silicon Teens, deren schrägelektronische Coverversionen von Sixtieshits für Furore sorgten: hinter dem Namen Silicon Teens verbarg sich Miller selbst, eine “Band” gab es nicht. Silicon Teens waren eine rein fiktive Bubblegum-Teenieband und bis heute erzielen ihre Platten Höchstpreise bei ebay und sonstigen Börsen. Miller sagt heute, dass ein gewisser Sinn für Humor alle Mute-Bands und -Künstler eint und das trifft auf Leute wie Vince Clarke und seine very-british-attitude gewiss zu. Wen man allerdings nur recht schwer mit irgendeiner Art von Humor in Verbindung bringen kann, ist der amerikanische Experimental-Elektroniker, Satanist und Bürgerschreck Boyd Rice, der solo und mit seinem Bandprojekt NoN viele Platten bei Mute veröffentlichte. Daniel Miller war beeindruckt von Rice' dekonstruktivistischen Lärmattacken: Rice zerlegte Teen-Hits in ihre Einzelteile und loopte winzige snippets wieder und wieder, bis ein absolut gruseliger Effekt entstand. Rice numerierte diese “loop edits” durch, die auf allen Geschwindigkeiten abspielbar waren, vermarktbare Zugeständnisse standen bei Rice/NoN nie zur Debatte. Silicon Teens und Boyd Rice/NoN markierten schon zu Anfangszeiten des Labels die verschiedenen Säulen, auf denen Mute stand: leicht goutierbarer Elektro mit definitivem Popappeal auf der einen Seite, schwerverdaulicher Experimentalkrach auf der anderen. So sollte es weitergehen, Mute baute aus: Daniel Miller veröffentlichte “Kebabträume” von DAF, holte Smegma und Robert Rental ins Boot und traf 1981 auf die Band, die das erfolgreichste Mute-Baby werden sollte: vier grünschnäblige Jungs aus Basildon, die sich Depeche Mode nannten. Bis heute ist DeMo Mute treu geblieben und bis heute teilen sich (unbestätigten Quellen zufolge) Label und Band die Erlöse 50:50, ganz so, wie es im ursprünglichen Vertrag besiegelt wurde. Als DeMo-Songschreiber Vince Clarke die Band nach den ersten vielversprechenden Singles und der LP “Speak and Spell” aus persönlichen Gründen verließ, blieb er Mute dennoch treu: zusammen mit der Bluessängerin Alison Moyet gründete er Yazoo und sorgte mit Hits wie “Don't Go” und “Nobody's Diary” für Mutes erste großen Charterfolge. In diesem Jahr – 1982 – bewies Mute, dass es unter diesem Namen möglich war, im Pop-Mainstream anzukommen und gleichzeitig für anspruchsvolle Elektronik-Avantgarde zu stehen. Miller signte Andreas Dorau und die Marinas, deren “Fred vom Jupiter” in Deutschland bei AtaTak erschienen war. Dank Mute ging der Song um die Welt, zumindest bis nach Great Britain. Dorau blieb nicht der einzige deutsche Act auf Mute: Miller begeisterte sich sehr für die Einstürzenden Neubauten und Liaisons Dangereuses, die einige Singles und Alben bei Mute herausbrachten. 1983 brach Miller die ungeschriebene Regel, nur rein elektronische Musik zu veröffentlichen: Nick Cave und Birthday Party dockten bei Mute an. The Birthday Party lösten sich nach ihrer Mute-EP “Mutiny” zwar umgehend auf, Nick Cave blieb mit seinen Bad Seeds dem Label aber erhalten – und auch Caves aktuelles Projekt Grinderman erschien bei Mute. Nicht alle Mute-Acts waren erfolgreich, einige versanken sang- und klanglos in den Annalen der Popgeschichte: Duet Emmo zum Beispiel, ein Projekt des Wire-Musikers Bruce Gilbert, blieb ein Insidertipp; die Band I Start Counting erreichte nicht mehr, als eine Randnotiz der Postpunk-Ära zu werden.
Im Jahre 2002 wurde Mute von EMI gekauft und besteht mittlerweile aus verschiedenen Sublabels wie zum Beispiel novamute und Blast First. Es existieren Niederlassungen in den USA und Deutschland. Nach seinen bescheidenen Anfängen in einem Schlafzimmer im Norden Londons operiert Mute inzwischen weltweit und ist längst kein Indielabel mehr.
Geblieben ist aber der experimentelle Ansatz, der Wunsch und Wille, charttauglichen Glampop zu machen und gleichzeitig der Avantgarde eine Heimstatt zu geben. Goldfrapp, Moby, Erasure und – nicht zu vergessen – Depeche Mode halten Mute die Treue und haben das Label sicher ins 21. Jahrhundert geführt, und es sieht nicht so aus, als fiele Mute nichts mehr ein.
Jetzt – und wir kommen zum eigentlichen Anlass für diesen Artikel – beginnt Mute, seinen Backkatalog wieder zu veröffentlichen. Den Anfang macht das grandiose Boxset Mute Audio Documents 1978 – 1984, das nicht weniger als 128 Songs auf zehn CDs versammelt. Auf den CDs befinden sich alle Mute-Singles (jeweils A- und B-Seiten) aus diesen Jahren, dazu kommen einige Albumtracks von Bands, die keine Singles herausbrachten und Raritäten in Form von Liveaufnahmen und bisher unveröffentlichten Tracks. Die aufwändig ausgestattete Box beinhaltet ein ausführliches Booklet mit Linernotes von Chris Bohn, Stephen Dalton, Ian Johnston und Dave Henderson, ein Interview mit Daniel Miller und Abbildungen aller Mute-Cover, einige Zeitungsartikel und Livefotos. Ausserdem: ein Poster der von Daniel Miller gestalteten Werbeanzeige für “Warm Leatherette”.
Da an dieser Stelle unmöglich alle 128 Songs der Box aufgezählt werden können, greifen wir wahllos einige Highlights heraus: “Collapsing New People”/Fad Gadget, “Kalte Sterne”/Einstürzende Neubauten, “In the Ghetto”/Nick Cave & The Bad Seeds, “Everything Counts”/Depeche Mode, “Never Never”/The Assembly, “Only You”/Yazoo, “Rise”/NoN, “Los Ninos del Parque”/Liaisons Dangereuses und natürlich “Warm Leatherette/TVOD” von The Normal, die Platte, mit der alles begann …
» www.mute.de
» www.mute.com