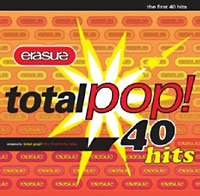| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
Depeche Mode: Sounds of the Universe Depeche Mode existieren seit 1980 und haben gerade mit „Sounds of the Universe“ ihr zwölftes Studioalbum veröffentlicht – für Millionen in den Spät-Sechzigern bis mittleren Siebzigern geborene Menschen gehören DeMo untrennbar zum Soundtrack fürs Leben. Aber wie klingen Depeche Mode für jemand, der/die ungefähr elf Jahre alt ist und die Band zum ersten Mal hört? Ist ihr Eindruck so wie meiner, als ich die Stones-Platten meiner Mutter hörte und dachte, „ganz okay, wenn man bedenkt, wie alt die schon sind“? Was hört ein Pre-Teen, der auf La Fee und Tokio Hotel geeicht ist? Zunächst mal ein knapp einminütiges Fiepen und Brummen, DeMo halten die Aufnahmegeräte mitten rein ins Universum und was von dort kommt, ist (weißes) Rauschen. „Mach neu mit alt“, dachte sich Keyboarder Andy Fletcher und besorgte sich olle Geräte vom Trödel: eine tiefgreifende Änderung zur üblichen Arbeitsweise, die von neuester Technik geprägt war. Fletch quält die antiken Synthies, die Maschinen ächzen und quietschen, alle Tracks, auch Balladen wie das zarte „Fragile Tension“ sind von Störgeräuschen durchzogen, als wollten DeMo in jedem Song aufs Neue zeigen, dass sie keine Hit-Band sind, dass ihnen an Dekonstruktion mehr liegt als an eingängigen Popharmonien. Aber sie können nicht ganz aus ihrer Haut: das typische Soundgemisch aus melancholisch fließenden Synth-Melodien und Dave Gahans Bariton verrät die Urheber sofort. Auch die Texte sind wie gewohnt tendenziell depressiv und voller Zweifel, handeln vom Scheitern, Alleinsein, Betrogen werden, von Falschheit und Verblendung. Klar ist auch: alte Fans kaufen neue DeMo-Alben nicht deswegen, weil sie Hits erwarten. Die Melodien spielen kaum eine Rolle, wichtig ist der Sound, in dem man sich wohl und vertraut fühlt – trotz der Irritationen auf „Sounds of the Universe“. Die Single „Wrong“ hingegen ist ein sicherer Hit, mit einprägsamem Text und einem ziemlich stumpfen Beat, die Gahan-Kompositionen (ja, er darf auch dieses Mal wieder) „Miles Away/The Truth Is“ und „Come Back“ sind mit hypnotischen Gitarrenläufen tanzbar und clubtauglich, die von Martin Gores gesungene Ballade „Jezebel“ weist in Richtung Kunstlied. Trotz aller Häutungsversuche der Band: Depeche Mode-Fans müssen einsehen, dass sie genau so sind wie ihre Eltern, die jedes Jahr zum allerletzten Stones-Konzert pilgern. ◊ ◊ ◊
Erasure: Total Pop – The First 40 Hits Ein bisschen gemein, aber so ist das Geschäft: bei amazon.de steht, dass Erasures neues Greatest Hits-Album häufig zusammen mit Depeche Modes „Sounds of the Universe“ gekauft wird, quasi als schnell angeklickter Mitnahmeartikel zum Hauptprodukt. Erasure wurden lange Zeit ungerechterweise als Nebenprojekt von Depeche Mode angesehen, weil Elektro-Wizard Vince Clarke seinerzeit bei DeMo ausstieg und nach Inkarnationen bei Yazoo und The Assembly schließlich mit Andy Bell das Elektropop-Duo Erasure gründete. Ähnlichkeiten gibt es natürlich: den jahrzehntelangen Erfolg, eine treue Fanschar auf der ganzen Welt und unkaputtbare Hits aus den Achtzigern („Sometimes“, „Oh L'Amour“), die die Neuveröffentlichungen überstrahlen. Vor siebzehn (!) Jahren erschien „Pop! 20 Hits“, ein erstes Best of-Album von Erasure, inzwischen sind viele erfolgreiche Songs dazugekommen, z.B. „Always“, „Run to the Sun“, „Solsbury Hill“, „Breathe“, „Don't Say You Love Me“ und „Here I Go Impossible Again“. Wer „20 Hits“ damals nicht gekauft hat, braucht sich nicht zu grämen, sind alle mit auf der 40-Doppel-CD drauf! ◊ ◊ ◊
The Juan MacLean: The Future Will Come „The Future Will Come“ ist kein echtes Konzeptalbum, aber nah dran: The Juan MacLean, Ex-Gitarrist der Six Finger Satellites und seit einigen Jahren erfolgreicher Elektromusiker und -produzent, hat sich vorgenommen, Human Leagues Hitalbum „Dare“ von 1981 ein Denkmal zu setzen. Nicht Human Leagues allüberall gesampletes Alternative-Disco-Stück „Being Boiled“ interessierte MacLean, sondern die seiner Meinung nach bahnbrechenden Soundexperimente der League in Kombination mit unwiderstehlichen Popmelodien auf eben „Dare“. Nun ist „The Future Will Come“ kein 1:1-Rip off des knapp dreißig Jahre alten Vorbilds, ein zweites „Don't You Want Me“ sucht man vergebens, auch wenn MacLean und seine musikalische Partnerin Nancy Whang abwechselnd und sogar im Duett singen wie einst Phil Oakley mit Susanne Sulley und Joanne Catherall. Andererseits sind die Anleihen und Zitate überdeutlich, Fetischisten können beide Alben parallel hören, um zu untersuchen, welcher MacLean-Track sich auf welchen Human League-Song beruft. Zum Step-back-in-time-Konzept passen auch die – damals modernen, heute angestaubten – Lyrics á la „the future will come“, „your body's human“, „this is just the start“. Für Menschen etwas fortgeschritteneren Alters (35 +) ist das ein merkwürdiges und verwirrendes Erlebnis: „The Future Will Come“ klingt alt, ist aber neu. Was bedeuten kann, dass Human League ihrer Zeit tatsächlich enorm voraus waren oder die eigenen Hörgewohnheiten es sich im Jahr 1981 gemütlich gemacht haben und froh sind, mal wieder „guten alten Stoff“ zu bekommen. Aber man sollte nicht allzu viel grübeln: „The Future Will Come“ ist durchweg tanzbar, die Songs sind gut, zudem hört Juan MacLeans Perlensuche nicht beim Eighties-Wavepop auf. In Tracks wie „Tonight“ und vor allem „Happy House“ läßt er goldene Early-House-Zeiten wieder auferstehen und macht das so opulent und hinreißend, dass es am Ende völlig egal ist, aus welchem Jahr diese Platte stammt. ◊ ◊ ◊
Filthy Dukes: Nonsense in the Dark Ihren Albumtitel erklären die drei Londonder DJs, Remixer, Producer und Partyveranstalter Olly Dixon, Tim Lawton und Mark Ralph damit, dass sie eben sehr viel „Unsinn im Dunkeln“ machen würden – britisches Understatement. Denn Dixon, Lawton und Ralph sind vor allem als Produzenten die hotteste Crème de la Crème, weshalb fast alle angesagten britischen Bands schon von den dreien „behandelt“ wurden. Aber nur anderer Leute Musik aufzulegen oder aufzupolieren genügte den Herren nicht mehr: mit Filthy Dukes war schnell ein passender Bandname gefunden, die Songs erarbeitete man sich in mühsamer Studiokleinarbeit (angeblich krempelten die Dukes ihr Dasein als Nachtschattengewächse komplett um und fanden sich ein ganzes Jahr lang jeden Morgen um zehn Uhr brav im Studio ein) – und das Ergebnis ist eine Wucht: die Filthy Dukes sehen in einer melodiösen Mixtur aus Techno und House den kommenden Dance-Trend und nehmen diesen auf „Nonsense in the Dark“ schon mal herzhaft vorweg. Der basslastige Hit „This Rhythm“ knallt genauso unwiderstehlich wie die Space-Disco-Experimente „You Better Stop“ und „Cul-de-Sac“, „Tupac Robot Club Rock“ zieht den Hut vor R'n'B und Daft Punk (in einem Track!), der Titelsong spielt mit Achtziger-Elektropop-Pathos – Pop ist die Zauberformel, die die Filthy Dukes äußerst wirkungsvoll einsetzen und so einen Bogen von Kraftwerk über die Chemical Brothers und LCD Soundsystem bis zu Hot Chip schlagen. Alles geht, alles paßt: aber nur, wenn man sein Handwerk so gut versteht wie die drei dreckigen Dukes. ◊ ◊ ◊
The Pains of Being Pure at Heart „For Fans of: My Bloody Valentine, The Smiths, The Jesus and Mary Chain, The Vivian Girls C86“, so preist das Presseinfo das Debütalbum der New Yorker Band The Pains of Being Pure at Heart an und damit ist eigentlich schon alles gesagt... aber halt: wir möchten noch erwähnen, dass aus jedem einzelnen Ton dieser Platte Sonnenlicht und jugendlicher Überschwang klingen, dass TPOBPAH zwar ganz offensichtlich den jangly Noisepop von Jesus and Mary Chain lieben, aber ohne deren depressiv-kaputte Düsternis auskommen, dass man sich bei Songs wie „This Love is Fucking Right“ nicht nur wieder wie ca. 17 fühlt, sondern dazu auch wie wild auf seinem Bett herumhüpfen möchte, dass man seine alten Platten von Transvision Vamp, den Primitives, The La's, The Sundays oder House of Love wieder hervorholen sollte, ohne sich dabei als ewiggestriger Achtziger-Freak zu fühlen, dass das 4-Leute-mit-den-üblichen-Rockinstrumenten manchmal doch das einzig Wahre sind, und ja, dass Musik glücklich macht.◊ ◊ ◊
„It must schwing!“ Blue Note wird 70! Kaum eine andere Plattenfirma genießt einen so legendären Ruf wie das 1939 von Alfred Lion, einem nach New York emigrierten Berliner Juden gegründete Jazz-Label, das in musikalischer und designästhetischer Weise stilprägend werden sollte. Blue Note bestand zu Beginn aus Lion und dem Schriftsteller Max Margulis, der die Finanzierung übernahm. Anfang der vierziger Jahre kam auch Lions Jugendfreund, der Fotograf Francis Wolff nach New York, der künftig für das unverwechselbare Design der Blue Note-Plattencover sorgte. Blue Note war bekannt für den äußerst freundlichen Umgang mit seinen Künstlern: selbst Übungsstunden wurden bezahlt. Die ersten Veröffentlichungen stammten hauptsächlich aus dem Hot Jazz- und Boogie Woogie-Bereich, mit „Summertime“ von Sidney Bechet verzeichnete Blue Note seinen ersten veritablen Hit. Mit dem Aufkommen von Bebop tummelten sich bald die angesagtesten Jazzmusiker bei Lion und Wolff: Bud Powell, John Coltrane, Miles Davis, Ornette Coleman, Thelonious Monk. Alle nahmen in Rudy van Gelders Studio auf, dessen charakteristischer Sound untrennbar mit Blue Note verbunden ist – einen Satz mußten allerdings alle Musiker und Producer berücksichtigen: „It must schwing!“ - für Lion und Wolff das A und O einer Jazzplatte. Seit Mitte der sechziger Jahre hat Blue Note eine wechselvolle Laufbahn hinter sich: das Label wurde mehrfach an andere Firmen verkauft, seit 1985 gehören die Rechte an alten Aufnahmen Capitol Records/EMI, EMI vertreibt auch heute aktuelle Blue Note-Alben, zum Beispiel diese beiden prächtig ausgestatteten CD-Boxen: „Blue Note“ versammelt auf drei CDs 40 Klassiker und neuere Songs, die einen umfassenden Überblick über das Blue Note-Oevre bieten. Überwiegen auf CD 1 und 2 noch lange, wilde Stücke mit Improvisationscharakter (z.B. Cannonball Adderleys „Autumn Leaves“ oder „Moanin'“ von Art Blakey & The Jazz Messengers), finden sich auf CD 3 aktuelle KünstlerInnen, die Pop und Jazz charttauglich vereinen: Norah Jones, Pat Metheney, Holly Cole, Cassandra Wilson, Bobby McFerrin, US3 (mit ihrem Herbie Hancock-Cover „Cantaloop“) und viele mehr. Auch Tenorsaxophonist Dexter Gordon bekommt zum Jubiläum eine gediegene CD-Box: der 1990 verstorbene Gordon galt nie als musikalischer Revolutionär wie Coltrane oder Charlie Parker, aber seine Eigenart, immer ein bißchen hinter dem Tempo zu bleiben, das Tempo zu verschleppen, beeinflußt bis heute viele Jazz-Saxophonisten. Das Best Of-Album greift auf Sessionaufnahmen der frühen Sechziger zurück und beinhaltet Tracks wie „Cheese Cake“, „A Night in Tunisia“, „Modal Mood“ und weitere Klassiker. ◊ ◊ ◊
Shirley Lee Shirley Lee ist Sänger und Songwriter der Londoner Band Spearmint, die sich hier zu Lande einer kleinen, aber treuen Fanschar erfreut. Leider ist der Spearmint-Stern zurzeit im Sinken begriffen und Lee sah sich gezwungen, einen kleinen Trick anzuwenden und Spearmint als Shirley Lee neu zu erfinden – in der Hoffnung, dass auch nicht-Spearmint-Fans sein Album kaufen. Seine Platte klingt allerdings nicht nach Kalkül oder marketingstrategischen Überlegungen, sondern ist im allerbesten Sinn ein liebenswertes, ehrliches, gitarrenbetontes Indiepop-Album mit sehr persönlichen Liebesliedern. Lee schöpft aus einem großen Fundus, der bei Burt Bacharach, Prefab Sprout, den Go-Betweens und Aztec Camera anfängt und am Schluß bei seiner eigenen Band ankommt. Beim instrumentalen „London Ghost Stories“ fühlt man sich in einen Schwarz/Weiß-Film aus den sechziger Jahren versetzt, überhaupt tauchen häufig Stars vergangener Zeiten in Lees Lyrics auf: Jacques Tati, Chet Baker, Scott Walker... aber er wird auch etwas moderner: „Come on Feel the Lemonheads“ erzählt die Geschichte eines Pärchens, dessen Liebesleben stark von der Musik einer gewissen Band bestimmt wird; „Walked Away“ fällt mit seinem dynamischen Bass und den rockigen Gitarren aus dem ansonsten eher verträumten Midtempo-Rahmen – ob Shirley Lee mit diesem sehr schönen, aber auch altmodischen Album neue Käuferschichten erreichen kann, muss leider in Frage gestellt werden. Spearmint-Fans sollten aber bedenkenlos zugreifen! ◊ ◊ ◊
Gomez: A New Tide Ein wenig in Vergessenheit geraten sind im deutschsprachigen Raum die fünf Engländer Gomez, die 1998 gleich mit ihrem Debüt „Bring it on“ den Mercury Music Prize gewannen und mit ihrem entspannt verspielten, oft auch blueslastigen Gitarrenpop vor allem im UK und in den USA erfolgreich sind. „A new tide“ ist das insgesamt sechste Album der Musiker um die Sänger und Gitarristen Ian Ball und Ben Ottewell. Und das zweite, das nach dem Abschied vom Major Virgin eingespielt wurde. Veränderungen gibt es im musikalischen Kosmos der Band nicht, deren Mitglieder mittlerweile über England und die USA verstreut leben. Wer die relaxten, facettenreichen Gitarrentracks dieses Quintetts mag, das nie wirklich einen Platz unter den hippen Zeitgenossen in der britischen Heimat hatte, der wird auch „A new tide“ lieben, das mit Songs wie „Mix“ und „Little Pieces“ einen bedächtigen Einstieg hat, mittendrin mit „Win Park Slope“ und „Bone Tired“ richtig Spaß macht und mit „Airstream Driver“ sogar eine melodischen Ohrwurm liefert, der als Schönheit dieses Albums gerne auch mal öfter gehört wird. „A new tide“ bringt ganz sicher keine neue Strömung, einen lockeren Soundtrack für einen entspannten Frühling aber auf jeden Fall. (Thomas Backs) ◊ ◊ ◊
Elijah: Beweg di Reggae scheint zu den Musikrichtungen zu gehören, bei denen Künstler aller Herren Länder mit großer Selbstverständlichkeit die Sprache ihrer Heimat verwenden und dennoch oder gerade deshalb authentisch sein möchten. Nur so lässt sich wohl erklären, dass der Züricher Musiker Elijah (man beachte das durch das „h“ am Ende erzeugte Wortspiel) auf seiner ersten CD Beweg di fast ausschließlich Schwyzerdütsch singt. Die Lieder haben daher so prägnante Namen wie uf min wäg und chum nöcher, die Lyrics sind für den durchschnittlichen Flachlandtiroler daher kaum zu ergründen, was man aber versteht, erscheint ganz dem Genre gemäß: Gute Energie si, Schlechte Energie no. Dazu noch einen leckeren Appenzeller geraucht und die negativen Vibes haben keine Chance mehr. Musikalisch ist das alles wirklich nicht schlecht und von der Instrumentierung auch ganz abwechslungsreich, der Gesang und das Idiom sind natürlich Geschmackssache. Wer ein großer Fan (z)eidgenössischer Musik ist und auch noch ein paar Fränkli auf dem Nümmerlikonto hat, der möge sich um Emils Willen diese CD kaufen. ◊ ◊ ◊
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |