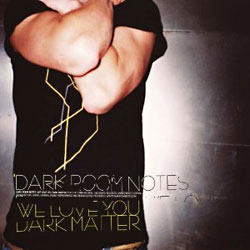| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
Crystal Castles (II) Am Anfang ist Rauschen... das zweite Album des kanadischen Duos Crystal Castles, das sich nach dem Schloss der TV-Comicheldin She-Ra benannte, beginnt mit Nicht-Musik. Störgeräusche, Rückkopplungen, Kreischen, Fiepen und Knarzen gehörten schon bei der ersten, ebenfalls schlicht “Crystal Castles” betitelten Platte zur sonischen Grundausstattung. Ethan Kath und Alice Glass sind Punks, Dekonstruktivisten: sie gehen mit Rock und Clubmusic ähnlich um wie die frühen Jesus And Mary Chain, die Mitte der 1980'er Jahre sanften Sixties-Pop mit Feedbackgewittern und düsterem Gesang zerschredderten. Crystal Castles sind – wie auch seinerzeit JAMC – auf ihrem Zweitling moderater und “hörbarer” geworden, ohne ihre grundsätzliche Haltung zum Pop aufzugeben. Nach wie vor verachten Kath und Glass das gängige Songschema Strophe-Strophe-Refrain. Melodien existieren nur als Splitter und Fragmente. Stimm- und Geräuschfetzen verhallen im Trockeneisnebel, hochgepitchte Elektrobeats brettern gnadenlos wie im schmerzhaft verzerrt-verwackelten “Doe Deer”. Dann wieder trashiger Klicker-Klacker-Techno mit süßen Harmonien, treibenden Euro-Disco-Klänge lassen bei “Intimate” und “Pap Smear” Clubatmosphäre aufkommen – bis sich das Rauschen und Knarzen wieder Bahn bricht. Samples von Stina Nordenstam sorgen in “Violent Dreams” und “Vietnam” für Sanftheit und entrückte Stimmung, “Year of Silence” (mit Sigur Rós-Sample) klingt, als würde ein Darkwave-DJ im Technotempel auflegen. Auf der Single “Celestica” singt Alice Glass sogar anstatt zu schreien, was sich richtig gut anhört. Undenkbar, dass eine Platte wie diese in einem “normalen” Studio produziert worden wäre: Aufgenommen wurde “Crystal Castles (II)” an ungewöhnlichen Orten wie einer Kirche in Island, einer Garage in Detroit und in einer kanadischen Hütte. Live suchen Crystal Castles direkten Kontakt und Konfrontation mit dem Publikum – auf Platte bleiben sie distanzierte Besucher aus einer anderen Welt, einem kristallenen Schloss. (CM) ◊ ◊ ◊
She & Him: Volume Two Vor knapp zwei Jahren veröffentlichten die Schauspielerin Zooey Deschanel und der Singer-/Songwriter M. Ward alias She & Him ihr Debütalbum “Volume One”. Folgerichtig heißt die neue Platte “Volume Two”, auf der das Duo wieder den Pop-Fundus der sechziger Jahre plündert – wobei “plündern” hier ganz freundlich gemeint ist. Deschanel/Ward haben nämlich ein sicheres Gespür für den perfekten Popsong: transparent, süß und leicht muss er sein; gefühlvoll, aber nicht zu kitschig. Gerne dürfen Anleihen bei Sixties-Girlgroups wie den Shangri-Las und den Ronettes gemacht und sich vor Sängerinnen wie Dusty Springfield verbeugt werden, die Songs sollten von Streicher, Piano, Handclaps und zarten Gitarrenklängen untermalt sein. Die Melodien müssen ans Herz gehen und zum Mitsingen sein, aber auch nicht zu vorhersehbar. Schwungvolle Gassenhauer und nachdenkliche Balladen sollten sich ungefähr die Waage halten. Die dreizehn Lieder auf “Volume Two” - She & Hims Eigenkompositionen und die Coverversionen von “Gonna Get Along Without You Now” (Original von Skeeter Davis) und “Ridin' in my Car” (NRBQ) - bieten all das und mehr: Zooey Deschanels Stimme ist zwar noch immer vorwiegend mädchenhaft und lieblich, wirkt aber selbstbewusster als auf “Volume One”. M. Ward legt mehr Verve in sein Gitarrenspiel, wodurch die Songs an Tiefe gewinnen. Natürlich kann man She & Him als rückwärtsgewandte Nostalgiker bezeichnen – aber wem bei Songs wie “In the Sun” (mit Tilly & The Wall als Backgroundchor), “Lingering Still” und dem sanften Schlaflied “If You Can´t Sleep” nicht das Herz aufgeht, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen. (CM) ◊ ◊ ◊
Peggy Sue: Fossils and other Phantoms Der Bandname führt auf eine falsche Fährte: das Trio Peggy Sue hat mit 50er-Jahre-Rock'n'Roll á la Buddy Holly nichts am Hut. Die Filmkomödie “Peggy Sue hat geheiratet” ist erst recht kein hilfreicher Link. Und dass Rosa Slade, Katy Young und Olly Joyce in Brighton, beziehungsweise neuerdings in London beheimatet sind, hört man ihrer Platte “Fossils and other Phantoms” nicht unbedingt an. Aber nochmal von vorn, denn Peggy Sue bestehen ja nicht nur aus Leerstellen und Irrtümern: Peggy Sue existieren seit 2005, hießen erst Peggy Sue & The Pirates, dann Peggy Sue & The Pictures, bis sich Rosa Slade entschloss, den Namen drastisch zu verkürzen. Das half, und Peggy Sue waren bald im Vorprogramm von Kate Nash, The Maccabees, Laura Marling und Mumford & Sons unterwegs. Peggy Sues Musik lebt in erster Linie vom Gesang der beiden Frauen, ein wenig fühlt man sich an das amerikanische Folk-Duo Indigo Girls erinnert: glockenklar alle beide, die Stimmen scheinen zu schweben, wirken aber niemals ätherisch-abgehoben, sondern fest und stark. Die Songs sind spröde und spartanisch arrangiert, wenn auch viele verschiedene Instrumente wie Ukulele, Saxophon, Geigen, Piano, Akkordeon und Mandoline eingesetzt werden. Das Ergebnis ist eindringlicher Folkpop mit Americana-Bezügen, der dank des energischen Perkussionisten Olly nicht in hippie'eske Gefilde abdriftet, sondern eher ungebügelt und kratzbürstig klingt. Wir wollen nicht gleich übertreiben und Vergleiche mit den Cramps bemühen, aber an manchen Stellen von “Fossils and other Phantoms” rumpelt und pumpelt es gewaltig, was für schöne Kontraste und damit ein überzeugendes Gesamtbild sorgt. (CM) ◊ ◊ ◊
Kelis: Flesh Tone Es klingt ja immer so schrecklich klischeehaft, dass Schwanger- und Mutterschaft eine Frau total verändern, bei der 30-jährigen New Yorkerin Kelis Rogers trifft diese Behauptung aber voll zu: Die Geburt ihres Söhnchens Knight (und die vorangegangene Trennung vom Gatten und Kindsvater, dem Rapper Nas) ließ die wilde HipHopperin mit orangefarbenem Afro und schrillen Klamotten zur selbstbewussten Mutter und Künstlerin reifen. O-Ton Kelis: “I adore being a mama, not just in an annoying, warm and fuzzy way, but in a triumphant women rock way.” Starke Worte, die auf ein starkes Album hoffen lassen: Mit “Flesh Tone” bewegt sich Kelis jedenfalls auf ganz anderem Parkett als man erwarten konnte. Kein markerschütterndes “I Hate You So Much Right Now”-Wutgebrüll wie auf ihrer frühen Single “Caught Out There”, kein anzüglicher Flirttalk wie beim Hit “Milkshake”, sondern... tja, ziemlich langweiliger, austauschbarer Elektro-Clubsound, unelastische 1-2-3-4-Eurodance-Rhythmen statt knackiger HipHop-Beats, überholte Autotune-Experimente, plastikglatte Techno-Grooves – wäre nicht Kelis' typisch kehlige Stimme, es könnte auch die Tonspur zum neuen Kylie-, Beyoncé- oder Christina-Album sein. Schade eigentlich, denn Kelis ist die Verrückteste und Sympathischste aller HipHop- und R'n'B-Ladies (siehe der orangefarbene Afro), ihre mütterliche Metamorphose auf will.I.Ams Label hätte gewagter ausfallen dürfen. Tracks wie “22nd Century”, “4th of July” oder “Emancipate” sind schlichtweg altmodisch in Sound und Inhalt, Textzeilen wie “”Your love is blinding, I´m already home, the lights are shining” (“Home”) zeugen nicht wirklich von “animalischer Inspiration”, die das Presseinfo verkündet. Natürlich gibt es auf “Flesh Tone” auch Lichtblicke wie das lasziv gehauchte Intro, die vom französischen Star-DJ David Guetta produzierte Single “Acapella” und die ehrlich anrührende Ballade für Kelis' kleinen Babyboy, “Song for the Baby”. Das war´s aber auch schon. Dass “Flesh Tone” nur knappe 37 Minuten lang ist, bedauert die Rezensentin nicht – sondern empfiehlt der frischgebackenen Mama Kelis einen zweiten Neustart. Oder doch die Weiterarbeit an ihrem Kochbuch*. (CM) ◊ ◊ ◊
Aerobatics: Fidelity Gefühlvoller Folk und Pop mit akustischer Gitarre sind sonst das Ding von Sänger Jonas Künne (Black Rust), Gitarrist Jan Koray macht mit seiner Frau Nic und dem Duo Monocular eigentlich TripHop. Die Debütalben dieser beiden Dortmunder Projekte haben wir hier 2009 vorgestellt. Jetzt haben sich Künne und Koray zusammen getan, um gemeinsam mit dem dritten Gitarristen Tom Forensico, David Senf (Bass) und Sven Kosakowski (Drums) als Aerobatics ihrer Vorliebe für Indie-Rock zu frönen. Die sechs Songs dieser ersten EP wurden in den ersten vier Monaten des Jahres aufgenommen. Entstanden sind melodisch-melancholische Songs wie „Closer“ und „Speechless“, die durchaus Lust auf mehr machen. „Nicht fett genug, da ist nichts hinter“ wird der ein oder andere Mucker und Metaller hier vielleicht nörgeln. Die Härte allein ist aber ganz sicher nicht der einzige Anspruch, den Künne, Koray und Co. mit diesem Debüt haben. Sonst wäre mit „Leaving“ zum Beispiel kein kleiner Hit enthalten, der Ohrwurmqualitäten hat. Und der Zuhörer würde auch nicht merken, dass Künne und Koray ganz schön vielseitige Musikliebhaber sind, von denen noch einiges zu erwarten ist. Die sechs Titel dieser EP können online als Downloads gekauft werden. Wer lieber eine Original-CD in den Händen halten möchte, der kann diese über die Website des Labels VierSieben Records ordern, „Fidelity“ ist in physischer Form auf 400 Exemplare limitiert. Auf dem Cover ist ein Luftakrobat abgebildet, dessen Facettenauge vom Silberling blickt. Könnte eine Libelle sein. (Thomas Backs) ◊ ◊ ◊
The Drums: The Drums Die Musikpresse hat sich geeinigt – die It-Band des Jahres 2010 heißt The Drums. Die Gründe liegen klar auf der Hand: Die jungen New Yorker liefern pünktlich zum wettertechnischen Sommerbeginn geradlinigen Pop, der für gute Laune sorgt. Die luftig-fröhlichen Melodien passen bestens in JEDES Radioprogramm. Dabei steht die Singalong-Mischung aus Surf-Rock und Indie-Pop im krassen Gegensatz zu Textzeilen wie „You're my best friend but then you died“. Damit packen die vier Jungs aus Brooklyn den Pop an der Wurzel – beim ersten Hören gutgelaunt daherkommende Lieder erschrecken bei genauerer Betrachtung mit todtraurigen Inhalten. The Drums lehnen sich gegen den Usus, unbeschwert klingende Gassenhauer müssen durch sinnentleerte Lyrics versaut werden, auf. Zudem ist das Album „The Drums“ endlich wieder eine universell einsetzbare Geheimwaffe für Treffen von Menschen mit unterschiedlichem Musikgeschmack. Einziger Wermutstropfen des Debüts ist die Deckungsgleichheit mit der hoch gelobten EP „Summertime!“ aus dem letzten Jahr. Nicht ganz unüblich im Musikgeschäft fanden zwei bereits dort vertretene Songs, „Down by the Water“ und der spritzige EP-Hit „Let’s Go Surfing“, ihren Weg auf das Album. Aber Hand aufs Herz, Nachwuchsmusikern vorzuwerfen, das selbstproduzierte, teilweise zur gleichen Zeit entstandene Debüt ist nur ein Abklatsch der EP, wäre dann wohl doch etwas unverfroren. Also, einfach mitsingen und Spaß haben! An The Drums wird in diesem Sommer niemand vorbeikommen. (Janine Andert) ◊ ◊ ◊
Various Artists: Next Stop ... Soweto So schmeckt Afrika!, verkündet der Flyer eines deutschen Supermarktes. In nahezu jedem größeren Geschäft stößt man auf die Flaggen und Fußbälle. Die Magie des Sports – das völkerverbindende Element, Glanz & Gloria aus einer vergangenen Zeit. 2010 ist es wieder soweit: Teams aus aller Welt treten gegeneinander an, diesmal an der Südspitze Afrikas. Selbstverständlich muß auch ein WM-Song eingespielt werden. Megasellerin Shakira darf sich dieser reizvollen Aufgabe annehmen und verwurstet ein Soldatenlied, das bereits von einer Gruppe aus Kamerun interpretiert wurde. Die FIFA läßt sich natürlich nicht gerne die Butter vom Brot nehmen und eigentlich leuchtet es ein, dass kommerziell erfolgreiche Interpeten den WM-Song stellen. Man muss etwas präsentieren – einen Weltverband für eine der schönsten Sportarten. ◊ ◊ ◊
Dark Room Notes: We Love You Dark Matter Electro-Clash ist wild: die wilde orgiastische Gewalt des Punkrocks wird mit treibenden Dance-Beats kombiniert und auf der Tanzfläche gibt es entsprechende Bewegungen. Dark Room Notes aus Irland passen nicht in dieses Bild, wie es zum Beispiel Hadouken! aus dem UK verkörpern: wilde junge ungezügelte Lust. In das Klischeeraster passt ein wenig, dass es sich bei einigen der Mitglieder um Kunststudenten handelt, besonders die Keyboarderin übt sich in der Fotografie und steuert konsequent eigene Arbeiten dem gemeinsamen Album „We Love You Dark Matter“ zu. Die Scheibe ist eingängig – hat dies unter Umständen ihrem Herkommen aus dem Indiepop-Bereich zu verdanken. Der Gesang gibt sich ein wenig extravagant: ähnlich wie The Cures Smith extrapoliert der Sänger von Dark Room Notes einzelne Worte. Die Musiker verweben in „stiller Weise“ (so seltsam das jetzt auch klingen mag) die Electronica-Einflüsse mit ihrem Gitarrenrock. Interessanterweise benutzten zu Anfang die Gründungsmitglieder Ruairi Ferrie und Ronan Gaughan statt eines menschlichen Bassisten den Synthesizer. Mittlerweile entfernten sie sich, unter anderem auch deshalb, weil sie auf talentierte (menschliche) Mitmusiker gestoßen sind, von der rein elektronischen Ausrichtung und nahmen das vorliegende Album live im Studio auf, um einen organischen Sound hinzubekommen. Beim Hören der Scheibe fällt die elektronische Ausrichtung nicht durchweg auf. Ein elektronischer Beat, ein Loop mischt sich in die Popsongs. Dark Room Notes komponieren aus einer Pop-Perspektive, was die Verbindung der Synthesizer mit den Gitarren und dem Schlagzeug gut ermöglicht. Die Iren bieten letzten Endes spannende Ideen und neben aller Eingängigkeit kommt der spielerische Anspruch nicht zu kurz. (Dominik Irtenkauf) ◊ ◊ ◊
Karen Elson: The Ghost Who Walks Wieder einmal übt sich ein erfolgreiches Model im Singen. Seit der Hochzeit mit White-Stripes-Frontmann Jack White 2005 wagt sich Karen Elson offiziell auf jobfremdes Terrain. Schon zwei Monate nach der Trauung veröffentlicht R.E.M.s Michael Stipe ein Stück von ihr. Im Jahr darauf covert sie zusammen mit Cat Power „Je t’aime... moi non plus“ von Serge Gainsbourg. Aber am Ende geht es über „hübsche Frau trällert nette Liedchen“ leider nicht hinaus. Outfit und Make-up im glamourösen Gothic-Style sind dennoch entzückend anzuschauen. Ganz abgesehen davon, dass Ehemann Jack White auf dem Debüt trommelt und die halbe Besetzung von The Dead Weather als Begleitband mit von der Partie ist. Artig versucht Frau Elson Außergewöhnliches zu präsentieren. Mal orgelt es durch die Songs, mal steht die singende Säge im Vordergrund, mal mischen Akkordeon, Geige und Klarinette mit. Zu all dem gesellen sich Kabarett-Einflüsse, als wollte sie Amanda Palmer Konkurrenz machen. Soweit geht das in Ordnung. Immerhin ist Karen seit 2006 Mitglied einer Kabarett-Truppe. Aber dann übertreibt sie. Elson hat bis auf das Rachelle-Garniez-Cover „Lunasa“ alle Songs selbst geschrieben und muss nun auch noch beweisen, wie umfangreich ihre musikalischen Kenntnisse sind. Die Melodie von „Stolen Roses“ ist bei Marianne Faithfull („Scarborough Fair“) geklaut. Die Intonation in „Garden“ orientiert sich an klassischen Frauenstimmen des 90er-Jahre-Rocks. „Cruel Summer“ gleicht einer Country-Nummer, die so auf eine Kirmes im Mittleren Westen Amerikas passt. Sollte das eine misslungene Anspielung auf Dolly Parton sein? Elson imitiert ausdrucksstarke Damen. Das spricht für ihren Musikgeschmack. Aber ihrer Stimme fehlt Präsenz, Ausdruck und das besondere Etwas. Theoretisch könnte das Konzept trotzdem aufgehen. Doch sowohl das Styling als auch der musikalische Grundtenor des Albums kommen wie ein Relikt aus den frühen 2000ern herüber. Zudem klingt „The Ghost Who Walks“ viel zu „amerikanisch“ für den europäischen Markt: Kaum zu glauben, dass Karen Elson Engländerin ist. ◊ ◊ ◊
Johnny Flynn: Been Listening Hinter dem Namen des Frontmanns Johnny Flynn verbirgt sich ein in Johannesburg geborener und in England aufgewachsener Schauspieler, Poet und Musiker nebst Band, The Sussex Wit. Der Einfachheit halber wurde der Bandname für den zweiten Longplayer „Been Listening“ gekürzt. Beheimatet ist die siebenköpfige Crew im Umfeld der aktuell Aufsehen erregenden Londoner Folkszene, die als Aushängeschild Mumford & Sons hervorbrachte. Eine neue Generation von Singer- /Songwritern, zu der KünstlerInnen wie Laura Marling, Noah and the Whale und Emy The Great gehören. Zusammen setzen sie eine Energie und Kraft frei, die mal eben ein ganzes Genre entstaubt. ◊ ◊ ◊
Rox: Memoirs “Mehr Soul als 100 Motown-Platten”, verkündet das neue Intro-Heft hysterisch – eine ganz schön gewagte Behauptung über die 21-jährige Roxanne Tania Tataei, wenn man bedenkt, dass Marvin Gaye, die Supremes und Stevie Wonder auf Motown veröffentlicht haben. Na ja, zurzeit ist es nicht so schwer, der neue (Retro-)Soul-Hype zu sein: aktuelle Platten von Amy Winehouse, Duffy oder Adele? Fehlanzeige, nix in Sicht, nirgends. Leichtes Spiel also für Rox, die Westlondonerin mit jamaikanisch-iranischen Wurzeln, die ihre Stimme in Kirchenchor und Musicalaufführungen trainierte und schon als junges Mädchen in Jazzcombos sang. ◊ ◊ ◊
Born Ruffians: Say It Ihr Debüt „Red, Yellow and Blue“ veröffentlichten die vier Kanadier als Studienanfänger. Das Nachfolgealbum erscheint nun zum Studienabschluss. Gerade einmal zwei Wochen dauerten die Aufnahmen zu „Say It“. Da blieb garantiert genug Zeit für die Prüfungsvorbereitungen. ◊ ◊ ◊
Mountain Man: Made the Harbor Hinter Mountain Man verbergen sich drei junge Frauen aus Vermont, USA. Molly Erin Sarle, Alexandra Sauser-Monning und Amelia Randall Meath studierten zusammen am Bennington College, wo sie eine Geschichte wie aus einem Hollywood-Film zusammenführte. Molly saß auf dem Fensterbrett und sang ohne Unterlass den „Dog Song“. Amelia hörte das, kam die Treppen heruntergestürzt und ließ sich das Lied beibringen, um es später wiederum an Alexandra weiterzugeben. Im darauf folgenden Frühjahr lernten sich auch Molly und Alexandra kennen. Alle drei sangen zum ersten Mal miteinander und Mountain Man war geboren. ◊ ◊ ◊
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |