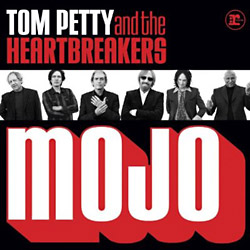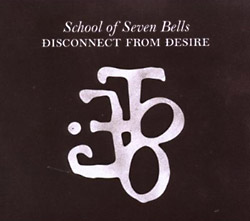| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
Gemma Ray – It’s A Shame About Gemma Ray »Its A Shame About Ray« nannten die Lemonheads 1992 einen Song und das dazugehörige Album – Gitarristin und Sängerin Gemma Ray aus Essex nutzt die Zeile für ein Wortspiel. Ausgerechnet diesen Song aber spielt sie auf ihrer neuen Platte nach ihrem Gastauftritt auf Michael J Sheehys »With These Hands« nicht. »It’s A Shame About Gemma Ray«, das dritte Album in drei Jahren, beinhaltet sechzehn Songs in Coverversionen oder besser Neuinterpretationen. Ray meint, sie habe die Lieder nicht etwa ausgesucht, um cool zu wirken oder eine Ehrennadel als verdiente Sammlerin einzuheimsen. Die Coversongs seien Momentaufnahmen ihrer Erinnerung. Und wenn überhaupt, dann haben die Songs sie gesucht. Die Tracks, denen das gelang, sind aber ohne Zweifel jeder für sich etwas Besonderes: Aufgeteilt in eine Boys- und eine Girls-Seite (mit einem Unisex-Zwischenspiel: Ray singt den Text von Sonic Youths »Drunken Butterfly« zur Titelmelodie von »Rosemary’s Baby«) werden Lieder von Gallon Drunk, Lee Hazlewood, Billie Holiday und Ella Fitzgerald in Gemmas typischen dunklen Psycho-Blues getaucht. Und verändern sich dabei manchmal total: »Touch Me I'm Sick«, Mudhoneys rausgeschrieene Grunge-Antihymne, offenbart durch Gemma Rays Bearbeitung ungeahnt zärtlich-melodische Facetten. Shirley Basseys »Big Spender« klingt hier ganz und gar nicht »big«, sondern unterschwellig gefährlich und düster. Auch das ohnehin nur vordergründig fröhliche »Bei mir bist du shein« von den Andrew Sisters und Buddy Hollys College-Rock'n'Roll-Hit »Everyday« zeigen erstaunlich dunkle Seiten. Dafür klingt »Ghost on the Highway« vom unvergessenen Gun Club, als hätte es Jeffrey Lee Pierce extra für Ray geschrieben – klar und melodiös, mit einem Hauch Tragik und Melancholie. Viel mehr als Rays Stimme und ihre geliebte Bigsby-E-Gitarre mit Vibrato, eine Hammondorgel und ein meist zurückhaltendes, zuweilen ordentlich rumpelndes Schlagzeug sind auf »It’s A Shame About Gemma Ray« nicht zu hören. Mehr brauchen die Songs auch nicht. Wie auf den Vorgängeralben »The Leader« und »Lights Out Zoltar!« ist die Produktion rau und die Stimmung somnambul – wie gemacht für die Stunden zwischen tiefer Nacht und frühem Morgen. [Christina Mohr] ◊ ◊ ◊
Menomena – Mines Drei Jungs sollt ihr sein: Brent Knopf, Danny Seim und Justin Harris. Jeder einzelne von ihnen würde jede andere Band wahrscheinlich zu einer großen machen. Bereits mit ihrem letzten Album »Friend And Foe« (2007) sorgten Menomena aus Portland (der Stadt der Wipers) für ein mächtiges Rauschen im Blätterwald. »Mines« ist insofern keine Überraschung und gerade deshalb umwerfend. Ebenso wie »The Suburbs« von Arcade Fire ist »Mines« eine dieser Platten, für die man letztendlich diesen ganzen Kram hier macht – wenn schon nicht für Kohle: Indie-Pop, der zwar Themen mathematisch durchspielt, immer wieder die Grenzen zwischen Laut und Leise austestet, beileibe nicht um jeden Preis gefallen will, aber dennoch unwiderstehlich klingt. Schicht um Schicht bauen Menomena ihre überzuckerten Torten auf, fügen Layer um Layer ihrer Flaming-Lips-Soundwaben aufeinander, während im Hintergrund das Schlagzeug wie zum Letzten Gericht hämmert. Dazu heult die Gitarre unter Schmerzen auf. Rock der Siebziger (»Taos«) zum Beispiel und das hedonistische Hymnengepose der Neunziger, das auch deutsche Bands wie Slut perfektionierten (»Killemall«), Gänsehaut-Refrains wie bei den Flaming Lips (»Dirty Cartoons«) – alles darf nebeneinander existieren, wenn nicht im selben Song, dann eben im nächsten. Wenn dann am Ende von »Mines« die Ballade »Intil« aus den Lautsprechern weht, dann ist das nicht im Entferntesten der Bruch, für den man das zunächst halten könnte, sondern die konsequente Fortführung der vorangegangenen Stunde, die eine stetige Verführung war. Man macht ja Bands wie Broken Social Scene (an die man im Zusammenhang mit Menomena auch immer denken muss) gerne den Vorwurf, sie würden mit durchsichtigen Mitteln auf die größte erreichbare Wirkung schielen. Mumpitz. Bands wie diese wollen und können gar nicht anders, als mit wissenschaftlicher Genauigkeit am Rande des Wahnsinns zu agieren. Bei Arcade Fire stimmte der Vorwurf sogar, bis auch sie mit »The Suburbs« all das auf fulminante Weise widerlegten. Kunst solle das ja auf keinen Fall sein, lässt sich Knopf des öfteren vernehmen – man sei eine Popgruppe, nicht mehr und nicht weniger. Sehen wir es so: Sie sind drei kleine Genies auf einem Haufen, jeder ist ein Songwriter, jeder ist ein Sänger, alle autark und alle unterwegs im Auftrag des guten Geschmacks. [Tina Manske]
◊ ◊ ◊
Tom Petty and the Heartbreakers – Mojo Versucht man, die klassische amerikanische Folk- und Country-beeinflusste Rockmusik chronologisch zu ordnen, lassen sich verschiedene Generationen definieren. Aus den Sechzigern kommen Dylan, Springsteen, Fogerty und – wenn man die Kanadier noch mitrechnet – Neil Young. Leute wie Tom Petty oder John Cougar haben ihre Wurzeln in den Siebzigern. Die Achtziger und Neunziger brachten dann die ersten Alben von Künstlern wie Steve Wynn oder Jeff Tweety (heute Wilco) mit ihren Bands. Schließlich würde ich Ryan Adams oder Connor Oberst der vierten, nennenswerten und aktuellen Generation zurechnen. Seit einigen Jahren heißt dieses Genre Americana und die genannten Künstler machen Album um Album und durchleben mal bessere, mal schlechtere Zeiten. Oben auf der Welle sind im Moment ganz klar Tom Petty and the Heartbreakers, die nach acht Jahren jetzt ihr neues Album »Mojo« veröffentlicht haben. Eingefleischter Petty-Fan bin ich bis jetzt nicht gewesen. Im Schrank habe ich die eine oder andere Scheibe: Alles solide, aber nie der ganz große Moment. Die neue Platte ist da anders: Das Album hat den Blues und mich gepackt. Das Eingangsstück »Jefferson Jericho Blues« kommt etwas langsamer daher und könnte auch von Dylan sein. Dann mit »First Flash Of Freedom« eine der psychedelisch angehauchten Nummern, die besonders schön geworden sind. »The Trip To Pirate’s Cove« ist die zweite dieses Kalibers. Selten habe ich, inklusive der Gitarre, eine so knochentrockene Rhythm-Section wie beim Boogie-Stomper »Candy« gehört. Auch Reggae wie »Don’t pull me over«, der bei ähnlich alten weißen Bands auch schon mal peinlich werden kann, kommt überzeugend rüber. Ansonsten angeblueste Rocker wie »Running Man’s Bible« oder »Good Enough«, dreckiger Rock ’n’ Roll im Stil von »I Should Have Known It« oder auch »Takin’ My Time«: Fünfzehn Lieder ohne Ausfälle. Und die Art der Darbietung? Ich bin wahrlich kein Freund von Muckertum, sprich der Zurschaustellung begnadeter Instrumentalität. Man kann seine Virtuosität aber auch in den Dienst der Songs stellen – und das genau machen die Heartbreakers. Herausragend ist Mike Campbell mit seiner »1959 Les Paul« und auch Benmont Tench an den Keyboards ist zweifelsohne ein Könner an seinem Instrument. Ohne große Overdubs, weitgehend live jeweils an einem Tag eingespielt, hört man der Platte ihre Authentizität und Frische bei jedem Ton an. [Wolfgang Buchholz]
◊ ◊ ◊
PVT: Church With No Magic Bei ihrem letzten Album hießen die Australier noch Pivot, und ihr Erstling »O Soundtrack My Heart« hatte die Durchschlagskraft einer Bombe. Post-Punk-Gitarren vibrierten, Drums und Bässe hämmerten. Warp-Gründer Steve Beckett war ebenso begeistert und schlau, das Trio als erste Band aus Down Under überhaupt bei seinem Label unter Vertrag zu nehmen. Mit »Church With No Magic« nun schlagen PVT – wie sie sich nach Querelen mit einer anderen Band namens Pivot jetzt nennen – eine neue Richtung ein. Im Namen wurden die Vokale entfernt, in der Musik hingegen ist das Vokale so präsent wie nie zuvor. Sänger und Multiinstrumentalist Richard Pike hat auf der neuen Platte eine tragende Rolle neben den schon zur geliebten Gewohnheit gewordenen Monsterbässen und -rhythmen. Das Ergebnis ist verblüffend. Bestes Beispiel ist die erste Single »Window«: Zum treibenden Schlagzeug gesellen sich ebenso manische Vokalparts aus der Konserve, darüber robbt sich der Sänger hymnenhaft an den synkopiert-gestolperten Refrain heran. PVT spielen den Hörer schwindlig. Man mache den Test und schaue das Video »Window« mit seinen abgehackten, schwankenden Bildern. Beim Titelsong aber wächst Richard Pike über sich hinaus: Diese Mischung aus Ian-Curtis-Dunkelheit, mitreißender Perkussion und absolut zwingenden Synthies gibt einem den Glauben daran zurück, dass die Achtziger eventuell doch das beste Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts waren. Auch sehr schön ist, wie bei »Crimson Swan« die Elektronik eiernd gegen ein souverän ausdauerndes Schlagzeug anrennt, nachdem sie sich durch ein melancholisches Portishead-Tal gekämpft hat. Wenn mit »Only The Wind Can Hear You« und seinem mehrstimmigen Fahrradklingeln das Album ausklingt, hat man einen mehr als halbstündigen Kraftakt hinter sich. Der neue Bandname mag für deutsche Ohren wie ein Reifen klingen, aus dem man die Luft raus lässt. Das nun aber wäre die grundfalsche Assoziation. [Tina Manske]
◊ ◊ ◊
School Of Seven Bells: Disconnect From Desire Mit ihrem Debüt »Alpinism« (2008) begeisterten SVIIB (wie sich School Of Seven Bells mittlerweile selbst mystifizieren) sowohl ihre Fangemeinde als auch die Kritikerhorde. Mit dem Nachfolger werden sie sogar noch poppiger. Die Hauptzutaten von School Of Seven Bells sind ja nicht schwer zu identifizieren: Da wäre 1. der Harmoniegesang von Alejandra und Claudia Deheza, da sind 2. die stampfenden Beats der Rhythmussektion, die im Gegensatz stehen zu den 3. ätherischen Melodien der Kompositionen. Fertig ist der perfekte Popsong – beziehungsweise hier mal wieder zehn an der Zahl. Seit ihrem letzten Erfolg haben SVIIB ausgiebig getourt und unter anderem Shows für Bat For Lashes und die White Lies eröffnet. Dabei konnte man überrascht feststellen, dass die Band auch live ihren breitflächigen Sound sehr gut rüberbringt. Die Erwartungen sind also hoch. Das Vergnügen beginnt mit »Windstorm«, das schon die Richtung vorgibt, denn SVIIB wollen gar nicht so mystisch sein, wie sie auf den ersten Blick klingen. Vielmehr streben sie durchsichtige, ebenmäßige Strukturen an: Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, alles ummantelt von elektronischen Spielereien, die wahnsinnig gut produziert sind – übrigens von Bandmitglied Benjamin Curtis himself. Beinahe rockig geht es weiter mit dem durchschaubaren »Babelonia«, gefolgt von einer – einmal mehr schwebenden musikalischen Reise durch weite harmonische Gefilde mit »Joviann«. Selbstzitate, warum denn nicht: »Camarilla« klingt verdammt nach ungefähr 90 Prozent des Debütalbums, beziehungsweise nach einer Perfektionierung desselben. Das allerdings ist Programm, worauf schon die drei letzterwähnten Songtitel hinweisen, die allesamt Motive und Themen von »Alpinism« aufnehmen. Die Kollegen von Pitchfork sprechen im Zusammenhang mit »Disconnect From Desire« von einem Wiedergänger des Madonna-Albums »Ray Of Light«, das in den 90er-Jahren insbesondere durch die tatkräftige Unterstützung von William Orbit und seinen Produktions-Skills der Tanzfläche eine Rundumerneuerung angedeihen ließ. Sicher ist: Dem Albumtitel möchte man als Hörer nicht folgen: Zwischen Dream-Pop, Afrobeat und IDM bleiben wir gerne verbunden. [Tina Manske]
◊ ◊ ◊
Stars – The Five Ghosts Die schlechte Nachricht zuerst: Arrangement und Produktion nerven. Die gute: Der Gesang und mit Abstrichen auch das Songmaterial sind überragend. Ja, die anfängliche Enttäuschung über das neue Album der Stars legt sich etwas. Im Sommer 2005 begeisterten mich die Kanadier eher zufällig bei einem Konzert in Münster. Selten hatte ich live so ausgereifte Gesangsharmonien gehört. Amy Millan und Torquil Campbell brillierten mit feinsten Duetten. Die Platte »Set Yourself On Fire« war ähnlich toll wie das Konzert und beinhaltete mit »Your Ex-Lover Is Dead« auch meinen persönlichen Song des Jahres. Auf ähnlichem Niveau war dann das an die Siebziger erinnernde »In Our Bedroom After The War« (2007). Diesen Sommer nun ist das neue Album »The Five Ghosts« erschienen. Irgendwo las ich etwas über die Gitarren-Indie-Band Stars. Nur, dass eine Gitarre weit und breit nicht zu hören ist. Keyboards in allen Facetten dominieren den Sound. Hallende Beats, Plastik-Synthies, blubbernde Sequenzer, ein Piano: Das alles klingt sehr auf Achtziger produziert, was weiß Gott nicht als Kompliment zu verstehen ist. Hört sich an wie Cock Robin, könnten Wohlmeinende sagen, Spötter hingegen auf Modern Talking verweisen. Mit einem Duett der beiden Sänger geht es auch diesmal los, bloß dass »Dead Hearts« nicht die Qualität letzten beiden Albumopener erreicht. Generell hat Amy Millan dieses Mal deutlich mehr Gesangsanteile. Dann eine Prefab Sproutsche Einleitung zu »Wasted Daylight« – deren letztes Album im Übrigen ja auch unterirdisch produziert war. Der Song selbst ist gut, ähnlich wie die beiden folgenden »I Died So I Could Haunt You« und »Fixed«. Komplett in die Eighties-Disco geht es dann mit »We Don’t Want Your Body« und »The Passenger«. Das Grauen springt einen frontal an. Zwei etwas dezenter produzierte Nummern finden sich mit »Changes« und »The Last Song Ever Written« im hinteren Teil der Platte. Hier lässt sich die Qualität der Lieder viel besser erkennen. Muss denn immer alles mit Soundteppichen zugekleistert werden? Wie man hört, geht es doch auch durchaus etwas weniger opulent. Ansonsten plätschern einige der Lieder belanglos vor sich hin. Die schönen Streicher der letzten Alben hört man auch nicht mehr raus. Das klingt dieses Mal alles eher nach Konserve. Es gibt keine Liner Notes bei der Platte. Wer für diese Produktion verantwortlich zeichnet, lässt sich nicht nachlesen. Mit Absicht? [Wolfgang Buchholz]
◊ ◊ ◊
Sky Larkin – Kaleide Gut anderthalb Jahre ist es her, dass Sky Larkin mit ihrem Debütalbum »The Golden Spike« leider zu wenig Aufmerksamkeit erregten. Die BBC stellte ihren Hörern die Platte als »one of the best records you mightn’t have heard in 2009« vor – und man darf mutmaßen, dass es dem Zweitling »Kaleide« kaum anders ergehen wird. Das ist schade, denn das Trio aus Leeds (Katie Harkin/Gesang + Gitarre, Douglas Adams/Bass, Nestor Matthews/Drums) feiert mit den zwölf neuen Stücken weiterhin konsequent die Schönheit der Dissonanz. Dieser Aspekt wird durch Albumtitel und -illustration (von Jack Hudson) unterstrichen: Man bemerkt nicht gleich, dass die schönen Bilder im Kaleidoskop aus zufällig gespiegelten Schnipseln und Splittern entstehen. Auf die Musik übertragen heißt das: Hier legt es niemand auf eingängige Hooks und Melodien an. Sky Larkin machen Stop- and Go-Musik. Gitarrenläufe werden jäh unterbrochen, das Schlagzeug stolpert mit voller Absicht, Katie Harkin singt mit viel Riot Grrrlsm in der Stimme rätselhafte Texte über Anjelica Houston, stillstehende Windmühlen und Kaffeetrinker. Das Energielevel ist hoch, doch Pogo tanzen kann man zu Sky Larkin nicht: Die schwindelerregenden Wechsel von brüsk zu lieblich und zurück machen aus »Kaleide« beinah ein Jazzalbum – aber eben nur beinah. Immer wieder klingen Verweise auf die Throwing Muses, Lemonheads und Sebadoh durch und verdeutlichen, dass Sky Larkins Wurzeln im Indie-Pop der späten Achtziger liegen. Aber Harkin, Adams und Matthews haben keine Zeit und keinen Anlass für Nostalgie. »Kaleide« spiegelt die Sounds und Bilder der Achtziger im Hier und Jetzt. Wie auch »The Golden Spike« entstand »Kaleide« unter John Goodmansons Ägide in Seattle. Vielleicht gedeiht dort die Kombination aus Art- und Collegerock besonders gut.
◊ ◊ ◊
|
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |