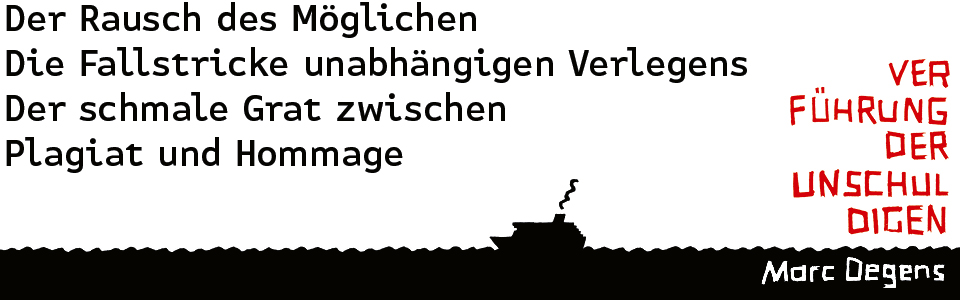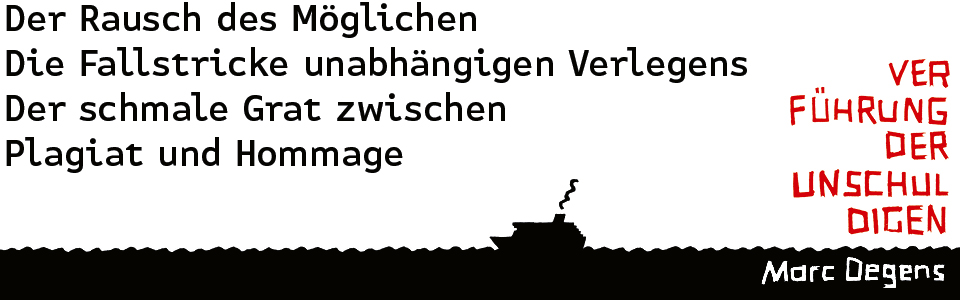Bilder © Darius Khondji / Prokino



 |
My Blueberry Nights
(R: Wong Kar-Wai)
USA / Hong Kong / China 2007, Buch: Wong Kar-Wai, Lawrence Block, Kamera: Darius Khondji, Schnitt, Production Design: Willam Chang Suk Ping, Musik: Ry Cooder, Kostüme: Willam Chang Suk Ping, Sharon Globerson, mit Norah Jones (Elizabeth), Jude Law (Jeremy), Natalie Portman (Leslie), Rachel Weisz (Sue Lynne), David Strathairn (Arnie), Chan Marshall [aka Cat Power] (Katya), 95 Min., Kinostart: 24. Januar 2008
Wong Kar-Wai sieht laut Zitat sein gesamtes Filmschaffen als einen einzigen langen Film, in dem jeder “wirkliche” Film den Status einer Szene innehat. Das gibt insofern Sinn, wenn man sich die Entwicklung seiner frühen Filme bis hin zum fast sphinxartigen 2046 verfolgt, der einerseits die typischen Wong-Themen aufs I-Tüpfelchen präzisiert zeigt, andererseits aber auch den nicht eingeweihten Betrachter klar außen vor lässt. Doch wie soll man diesen “Lebensfilm” weiterführen, ohne schon per definitionem die potentielle Gruppe der Zuschauer immer weiter zusammenschrumpfen zu lassen? Mit einem Neuanfang auf intellektuell geringerem Niveau.
Für Wong Kar-Wai bedeutet dies seinen ersten englischsprachigen Film. Über Hong Kong ist alles gesagt, nun nimmt er sich des Mythos Amerika an. Ähnliches haben auch Wim Wenders oder Lasse Hallström gemacht, mit unterschiedlichem Erfolg bei Kritik und Publikum. Bei Wong Kar-Wai sieht es nach My Blueberry Nights zunächst so aus, als hätte er zumindest die Kritik halbwegs zufriedengestellt und seinen Publikumszuspruch auch nicht unbedingt verringert, etwa so, wie es bei Wenders nach Paris, Texas aussah.
Doch auch wenn My Blueberry Nights ebenfalls ein Road Movie ist, dürfte der Vergleichsfilm aus dem weiteren Umfeld von Wim Wenders eher City of Angels sein, eine relativ straighte Liebesgeschichte, deren Schnörkel / Umwege nicht ganz darüber hinwegtäuschen können, wie seicht der eigentliche Kern des Films ist.
Der fulminant inszenierte erste Kuss (laut Presseheft die Arbeit mehrerer Wochen), die Kameraarbeit, bei der man glatt annehmen könnte, Christopher Doyle sei immer noch für die Bildmagie zuständig (Darius Khondij trägt die Fackel weiter), die Episoden, die an Filme wie Chungking Express erinnern (den ersten internationalen Erfolg des Regisseurs), der teilweise verzückende Soundtrack - vieles ist eine überzeugende Weiterführung des Wong’schen Lebensfilms. Die von David Strathairn gespielte Figur eines liebeskranken, suizidgefährdeten Polizisten könnte man fast als älteren alter ego einiger von Tony Leung gespielter Figuren interpretieren, und auch, was der Regisseur aus Natalie Portman rausholt, ist ein Erlebnis. Doch was ändert das an der eher mauen Liebesgeschichte zwischen Jude Law (der schauspielern kann, wenn er will, sich hier aber damit begnügt, seinen nicht mehr ganz jungenhaften Charme abzuspulen) und Norah Jones, einer Sängerin, der extra der Besuch von Schauspiel-Übungen untersagt wurde, damit sie ohne die übliche Gesichtsmotorik den Zuschauer in den drei Episoden mal in ein Tennessee-Williams-Universum, mal eine Chandler-Story und dann auch noch eine Geschichte wie von Paul Auster entführen soll. Hört sich ganz verlockend an, funktioniert aber allenfalls im Ansatz.
Wenn die eindeutige Identifikationsfigur eines Films ein wenig langweilig ist, und die “große Liebe” nur ein ziemlich plattes Jude-Law-Konstrukt ist (das allerdings bei dafür empfänglichen Damen - und natürlich Herren - durchaus noch funktioniert), dann wird die mit vielen Vorschußlorbeeren verzierte “erste amerikanische Arbeit” höchstens zu einem Appetithappen für das, was kommen mag. Aber, um nochmal auf den Vergleich mit Wenders zurückzukommen: Paris, Texas war auch nicht Wenders erster Amerika-Film, nur sein vermutlich am besten im Gedächtnis bleibender. Der wird bei Wong Kar-Wai noch erwartet, was natürlich mit der Philosophie seines “Lebens-Films” Hand in Hand geht ...