
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
5. Juni 2013 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|
|
 |
No Place on Earth
Kein Platz zum Leben
(Janet Tobias)
Originaltitel: No Place on Earth, UK / Deutschland / USA 2012, Kamera: César Charlone, Eduard Grau, Sean Kirby, Peter Simonite, Schnitt: Alexander Berner, Deirdre Slevin, Claus Wehlisch, Musik: John Piscitello, mit Chris Nicola, Saul Stermer, Sam Stermer, Sonia Dodyk, Sima Dodyk und den Darstellern Katalin Lábán (Esther Stermer), Péter Balázs Kiss (Saul Stermer), Dániel Hegedüs (Sol Wexler), Balázs Barna Hídvégi (Nissel Stermer), Fruzsina Pelikán (Sonia Dodyk), András Orosz (Sam Stermer), Mira Bonelli (Sima Dodyk), Norbert Gogan (Louie Wexler), 83 Min., Kinostart: 9. Mai 2013
Viele Knöpfe und ein Damenschuh. Der Höhlenforscher Chris Nicola entdeckt in der Ukraine Anzeichen eines Geheimnisses, das nicht prähistorisch ist, sondern von lebender Geschichte zeugt. Und einer Facette des Holocaust, die noch nicht ganz so totgetrampelt ist wie ein Großteil dieses schier unerschöpflichen Füllhorns dramatischer Geschichten.
Der Dokumentarfilm, der sich damit befasst, beginnt mit einer Reinszenierung des Fundes (Nicola spielt sich selbst), zeichnet dann die Suche nach den Zeitzeugen und Nachkommen nach, die sich einst für eine Rekordzeit vor den Nazis unter der Erde versteckten. Ein Großteil des Films besteht dann aus Spielszenen, die die damaligen Vorgänge nachspielen, jeweils verbunden mit dokumentarischen Interviews (und gelegentlichem Archivmaterial von Todeszügen oder Erhängungen), was der Film rein dramaturgisch ziemlich clever löst, denn die nicht wenigen Zeitebenen müssen sich ebenso sehr dem Betrachter ohne Probleme erschließen wie aus den zunächst fragmentarischen Schilderungen (viele der Zeitzeugen waren damals noch Kinder) eine flüssige Geschichte entstehen soll.
Zur Heldin wird hierbei die Matriarchin Esther Stermer, die nicht nur ihre Familie durch die dunklen Höhlengänge führte, sondern nebenbei auch noch Zeit fand, darüber zu schreiben (mittlerweile auch als We fight to survive publiziert). Ihre Schriften bilden das Rückgrat der Filmerzählung, die nebenbei auch immer wieder das ebenfalls mirakulöse Wiederfinden der damaligen Höhlenkinder schildert, die dann (»closure« muss sein) gemeinsam zur Höhle zurückkehren.
Als Purist habe ich normalerweise Probleme, wenn ein »Dokumentarfilm« in solch einem Ausmaß von Spielszenen geprägt ist. Doch ich muss zugeben, dass eine Beschränkung auf Interview-Schnipsel und vorgelesene Zeitdokumente, während der Höhlenforscher das Kamerateam auf Besonderheiten hinweist, dem Material nicht gerecht geworden wären. Und das Hand-in-Hand von Spielszenen und dokumentarischem ist hier teilweise schon erstaunlich meisterlich, angefangen mit der cleveren Entscheidung, die Aufnahmen der Interviews jeweils in verdunkelten Räumen mit nur einer Lichtquelle stattfinden zu lassen. Das schafft eine ähnliche Atmosphäre über Generationen und Kontinente hinweg.
Mein größter Kritikpunkt ist, dass für eine deutsche Koproduktion die Stimmen der Darsteller der Deutschen reichlich mäßig ausgefallen sind. Einerseits erfreut man sich (in der OV) an der Sprachenvielfalt von ukrainisch über englisch und deutsch bis hin zu vielen Mischformen des Jiddischen, andererseits spricht Esther mit den Deutschen fast ausschließlich Englisch, was dann doch produktionstechnisch mehr Sinn ergibt als aus dem damaligen Kontext.
No Place on Earth bietet aber nicht nur »living history«, zuschauerfreundlich aufbereitet, sondern auch einen durchaus spannenden Kinoabend. Der Kampf um Lebensmittel, die Ausflüge aus der Hölle (und die Versuche, in sie einzudringen), das Zusammentreffen mit ukrainischen Polizisten oder einem simplen Holzfäller – jedes kleine Detail kann über Gedeih und Verderb von 38 Menschenleben entscheiden. Das können die wenigsten Spielfilme so geschickt umsetzen wie dieser Doku-Mischling.
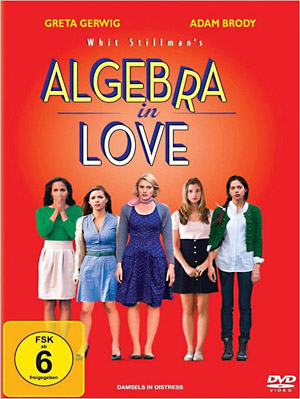 |
Algebra in Love
(Whit Stillman)
Originaltitel: Damsels in Distress, USA 2011, Buch: Whit Stillman, Kamera: Doug Emmett, Schnitt: Andrew Hafitz, Musik: Mark Suozzo, mit Greta Gerwig (Violet), Analeigh Tipton (Lily), Megalyn Echikunwoke (Rose), Carrie MacLemore (Heather), Adam Brody (Fred Packenstacker / Charlie Walker), Caitlin FitzGerald (Priss), Ryan Metcalf (Frank), Hugo Becker (Xavier), Jermaine Crawford (Jimbo), Zack Woods (Rick DeWolfe), Meredith Hagner (Alice), Billy Magnussen (Thor), Nick Blaemire (»Freak« Astaire), Aubrey Plaza (Depressed Debbie), Alia Shawkat (Mad Madge), 99 Min., bereits auf DVD erhältlich, ab 16. Mai 2013 im fsk Kino Berlin
Laut Ekkehard Knörer ist Damsels in Distress »ein zum Schreien komischer Film«. Ich muss zugeben, es fällt mir schwer, mir den Ekki überhaupt vor Lachen schreiend vorzustellen. Normalerweise bin ich einer derjenigen, die im Kino (nicht nur immer bei Qualitätsfilmen) mitunter so laut lachen, dass sie schon mal hinterher von Kollegen ermahnt werden (so geschehen bei Hai-Alarm am Müggelsee).
Damsels in Distress ist ein Film, bei dem mir die Humor-Elemente durchaus nicht entgehen. In äußerst satirischer Form pervertiert Whit Stillman Bestandteile solcher etwas besserer Highschool-Komödien wie Heathers oder Mean Girls, nur dass das Umfeld diesmal akademisch ist. Lily (Analeigh Tipton), eine neue an der Uni, wird von einer kleinen Gruppe »hilfsbereit« aufgenommen. Doch das Trio aus Violet (Greta Gerwig), Heather und Rose ist diesmal keine durchtriebene Zickengang, die ganz oben in der Hackordnung steht, sondern eher unscheinbar und recht ambivalent konnotiert. Violet ist so etwas wie eine Anführerin, auch wenn sie noch zielloser herumirrt als die anderen. Man hat sich hehren Zielen verschrieben, philosophiert etwa vor dem Schminkspiegel, dass man über Oberflächlichkeiten wie das Aussehen hinweg sehen solle, selbst die Intelligenz sei völlig überbewertet bei der Partnerwahl, denn einem vermeintlichen »Loser« könne man ja bei der Lebensführung behilflich sein, was wiederum das eigene Selbstwertgefühl unterstütze. Überhaupt scheinen die wichtigsten Aspekte des Hochschuldaseins Reinlichkeit und die Umschiffung von Depressionen zu sein.
Im »Suicide Prevention Center« kümmert man sich um jene, die gefährdet sind, sich von einem beliebten zweistöckigen Gebäude zu werfen, den Bewohnern eines besonders »anrüchigen« Dorms schickt man wohlriechende Seife, man organisiert eines Steptanzaufführung und initiiert eine Tanzbewegung, die die Welt revolutionieren soll.
Nebenbei geht es natürlich ähnlich wie bei Jane Austen (ich fühlte mich besonders an Emma bzw. Clueless erinnert und zwischendurch darf auch die Wanderung im Dauerregen nicht fehlen) um Beziehungsavancen, Liebeskummer oder religiös motivierte Sexualpraktiken, aber auch, wenn zum Schluss die meisten Figuren in Pärchen wie durch ein Musical tanzen, ist man von einer RomCom ungefähr so weit entfernt wie von einem Western. Stillman übt sich im gehobenen Scherz, der nicht jedermann umhauen wird. Wenn Lily etwa zu einem »Videodate« eingeladen wird und Xavier (!) Truffauts Baisers volés vorschlägt, fragt sie nach, ob der Film neu sei – oder zumindest in Farbe. Doch über die Unwissenden sollte man nicht die Nase rümpfen, denn die Hochschullaufbahn ist ja dafür geschaffen, das Wissen zu vermehren. Wozu soll man schon vorher sämtliche Erkenntnis angesammelt haben? Einer der liebenswerten Loser, mit Namen »Thor«, benutzt etwa ein geschätzt halbes Semester dafür, die Namen der Farben zu lernen, für die er sich zuvor nie interessiert hat. Und wenn er schließlich einen kompletten Regenbogen benennen kann, dann ist das wie eine bestandene Zwischenprüfung.
Und so gibt es allenthalben neue Erfahrungen (Artischocken), akademische Diskurse (Warum wird Xavier mit X geschrieben, Zorro jedoch mit Z?) und auch romantische Einsichten (»He is lying. I find that very attractive!«), und quasi der komplette Film ist Satire und Analogie. Nur stellte sich bei mir persönlich nie wirklich eine mehr als nur erkennende Wahrnehmung des Humors ein, wenn die vermeintliche Charleston-Expertin Violet beispielsweise bei einer Party verzückt einen »Golden Oldie« wiedererkennt (Euro-Disco-Mist aus den 1990ern).
Damsels in Distress ist ein durchweg gelungener Film, nur eben nicht für Jedermann. Die Dialoge sind feinziselliert, die darstellerischen Leistungen adäquat, die Musikeinsätze persiflieren gekonnt Hollywood-Konventionen, aber die Tanzeinlagen zeugen von echtem Herzblut und dem Charme vergangener Epochen. Wenn der Humor auch bei mir zünden würde, würde ich den Film lieben. Doch man kann die Liebe (selbst die Liebe zu einem Film) halt nicht wie bei einem Versuchsaufbau oder einer Gleichung erzwingen.
  |
Mutter und Sohn
(Calin Peter Netzer)
Originaltitel: Pozitia copilului, Intern. Titel: Child's Pose, Rumänien 2013, Buch: Razvan Radulescu, Calin Peter Netzer, Kamera: Andrei Butica, Schnitt: Dana Bunescu, mit Luminita Gheorghiu (Cornelia Kerenes), Bogdan Dumitrache (Barbu), Natasa Raab (Olga Cerchez), Florin Zamfirescu (Domnu Fagarasanu), Ilinca Goia (Carmen), Vlad Ivanov (Dinu Laurentiu), Mimi Branescu, Adrian Titieni (Father), 112 Min., Kinostart: 23. Mai 2013
Cornelia weiß, was sie will. Sie ist eine Architektin, Bestandteil der rumänischen High-Society. Wie eine Python im (liebevollen) Klammergriff hält sie ihren Sohn Barbu, den sie vor ungünstigen Faktoren beschützen will. Wie seiner Partnerin Carmen, die »mit ihm macht, was sie will«, ihn herumführt »wie eine Maus am Schwanz«. Das ist natürlich die Rolle, die die Mutter abonniert hat, sie will ihren Sohn komplett kontrollieren (natürlich nur zu seinem besten), sie fragt sogar die gemeinsame Putzfrau aus. Die Absurdität dieses Verhältnis zeigt sich etwa, wenn sie dem Sohn (mittlerweile über 30) ein Buch von Herta Müller schenkt, um dann enttäuscht festzustellen, dass er es nicht einmal gelesen hat. Zumindest zeigt sich an diesem Beispiel die Absurdität der Filmemacher, die über solche Hochkultur das Feuilleton erreichen wollen. Oder zumindest die Jury der Berlinale, die dem Film den Hauptpreis verlieh.
In eine Spannungshaltung gerät diese seltsame Mutter-Sohn-Liebe durch einen Autounfall. Barbu hat bei einem Überholmanöver einen Knaben erfasst, der kurz darauf verstarb. Cornelias Beschützerinstinkt greift sofort, mit ihrer Schwägerin bricht sie auf zur Polizeistation, greift in die laufenden Ermittlungen ein, korrigiert mit anwaltlicher Unterstützung die Aussagen ihres Sohnes und bereitet bereits eine schleichende Bestechung vor, die in diesem Film auf mindestens drei Ebenen avisiert wird: Bei den Behörden, bei den Klägern (die Eltern des toten Kindes) und bei einem Kronzeugen, der sich bei der Aushandlung des Bestechungsgeld besonders professionell zeigt.
Das politisch anspruchsvolle rumänische Kino hat sich in den letzten Jahren mehrfach vorgetan, dass es sich in diesem Fall um eine Produktion von »HBO Romania« handelt, zeigt auch, dass der internationale Markt darauf reagiert. Die Stilmittel sind die des europäischen Autorenkinos, etwa die intime Nähe der Kamera wie bei den Brüdern Dardenne, Alltagssituationen anstelle von »Filmfiguren« wie bei Mike Leigh oder Andreas Dresen, etwas befremdlich wirkt hier die wenig subtile Herangehensweise.
Die Schilderung der Feierfreude unter den oberen Zehntausend wirkt eher protzig als satirisch, Pelzmantel und Champagner scheinen unabkömmlich als Charakteristika der Hauptfigur Cornelia, die sich oft durch extreme Gefühlskälte auszeichnet, was schnell einen zynischen Humor entwickelt. Dem gegenüber baut der Film überdeutlich auf Emotionen – und zwar nicht in europäischen Dosen, sondern eher im Overkill, wie man ihn von Spielberg und Konsorten kennt.
Einerseits baut der Film darauf, dass der Zuschauer die Ambivalenz des dargestellten erkennt, andererseits wird alle überdeutlich betont. Als Beispiel ein Dialogauszug. Cornelia befolgt nicht immer selbst, was sie dem Sohn so predigt und vorzuschreiben versucht: »Ich paffe nur, aber du rauchst dir noch die Lunge kaputt.« Und dann der an fehlender Subtilität kaum zu überbietende Zusatz: »Carmen, du kannst ruhig rauchen, das ist kein Problem!« Das seltsame Verhältnis zwischen der Mutter und der Geliebten (wobei letztere langsam genug hat vom verhaltensgestörten Barbu) eröffnete mir die schönsten Momente des Films, mit einem eigentümlich unfreiwillig wirkenden Humor.
Doch dann drängt sich die Geschichte mit dem Autounfall doch in den Vordergrund, wobei aber die ansatzweise großartigen Szenen des Aufeinandertreffens mit den Kindseltern durch das inszenatorische Klotzen und allzu augenfällige Beharren auf »europäische« Kunstgriffe (die wie der Sohn im Auto eingesperrte Kamera kann nur hilflos beobachten) sehr in ihrem positiven Eindruck geschmälert werden. Für mich ist Pozitia copilului ein seltsam zwiespältiger Film: ich kann ihn nicht wirklich durchgehend gelungen bezeichnen, trotz einiger verunglückter Entscheidungen mag ich aber auch nicht komplett abraten. Wer sich generell für das rumänische Kino des letzten Jahrzehnts interessiert, kommt auch um diesen Film nicht umhin, aber wer noch einen Einstieg in die Nationalfilmographie sucht, sollte etwas höher greifen im Anfangsniveau.
Vom Berlinale-Wettbewerb habe ich zu wenig gesehen, um darüber zu urteilen, ob die Wahl des »Goldenen Bären« gerechtfertigt war. da der Film aber ohne diese Auszeichnung wohl keinen deutschen Kinostart beschert bekommen hätte, lassen wir das mal durchgehen.
 |
Das Weiterleben
der Ruth Klüger
(Renata Schmidtkunz)
Österreich / Deutschland 2011, Buch: Renata Schmidtkunz, Kamera: Avner Shahaf, Heribert Senegacnik, Oliver Indra, Schnitt: Gernot Grassl, Tanja Lesowsky, Musik: Norbert Rusz, Gerhard Guebel, mit Ruth Klüger, Percy Angress, Dan Angress, Laurie Angress, Gail Hart, Heribert Lehnert, Sigrid Löffler, Thedel von Wallmoden, Eva Geber, 82 Min., Kinostart: 9. Mai 2013
Wien, Kalifornien, Göttingen und Israel: das sind die vier verschiedenen »Heimatorte«, an und zu denen dieser Film seine Titelheldin begleitet. Ruth Klüger stammt aus Wien, wo sie ihre Kindheit unter den Nationalsozialisten verbrachte, ehe ihr über einige unerfreuliche Stationen die Flucht gelang und sie in den USA Literatur studierte, zunächst die englischsprachige, später – mit mehr Distanz – auch Germanistik. In den USA führte sie eine Ehe, der immerhin zwei Söhne entstammten, ehe sie als mittlerweile anerkannte Literaturwissenschaftlerin nach Europa zurückkehrte. In die verschlafene Universitätsstadt Göttingen (der Film findet hier fast nur heimatlich beschauliche Bilder), wo ihr autobiographischer Bestseller »weiter leben« entstand und erschien. Mittlerweile verbringt sie ihre Zeit aufgeteilt zwischen Kalifornien und Göttingen (mehrere Monate im Jahr in Europa), der Film dokumentiert aber auch eine Rückkehr nach Wien, wo sie gemeinsam mit einem Sohn und dessen Familie ein anderes Wien erlebt, weil ihr Buch dort – als Aktion der Stadt – in hunderttausend Exemplaren verschenkt wurde und sie als verehrter Gast der Stadt gefeiert wird.
Die stärksten Momente hat der Film dort, wo sich Ruth Klüger mit unerbittlicher Wahrheit den Widersprüchen ihrer eigenen Natur stellt. Wo sie etwa einerseits vom Stolz spricht, den sie empfindet, wenn ihre Nachfahren erleben, wie die für sie fremde Stadt sie feiert, dies aber dennoch nichts daran ändert, dass sie das als »judenkinderfeindlich« erlebte Wien »aus offensichtlichen Gründen« nicht als Heimatstadt empfindet. »Wiens Wunde, die ich bin, und meine Wunde, die Wien ist, sind unheilbar.«
Ich muss zugeben, dass ich mir aufgrund des Film auch das Buch »weiter leben« anschaffte, von dem ich zuvor nie gehört hatte. Doch das positive Bild der Filmfigur wurde durch die Bitterkeit und manchmal Borniertheit der Autobiografin geschmälert, was sich leicht dadurch erklärt, dass das Filmbild der Ruth Klüger durch die inzwischen befreundete Regisseurin Renata Schmidtkunz »gesäubert« wurde, die teilweise schmerzhafte Ehrlichkeit wird im Film mit Bedacht eingesetzt und gerade durch positive Aspekte wie eine neuempfundene Emotionalität gegenüber der Familie in ein anderes Licht gerückt. Im Nachhinein scheint teilweise durch, wie Ruth Klüger einige Elemente des Films wie »Unkraut« ausgejätet hätte (Gefühlsduseligkeit ist in ihrem Buch so gar nicht ihr Ding). Und irgendwie schätze ich den Film dadurch im Nachhinein noch eine Spur mehr. Zwar gibt es auch hier die unumgängliche »Rückkehr« nach Bergen-Belsen und den Besuch der Klagemauer in Jerusalem (das Klüger mehr als erboste Feministin als als Jüdin erlebt), aber die kleinen Zweigespräche zwischen der Titelheldin und der Regisseurin oder auch ihre Freunde in Kalifornien, die der Film nebenbei portraitiert (ein ehemals überzeugter Nazi und eine amerikanische Germanistin, die Klüger lehrte, verstaubte Klassiker wie Schiller mit modernem Avantgarde-Kino in bezug zu setzen), bringen einige Facetten ein, die ich im Buch schmerzlich vermisste.
Manche Geschichten sind zwar beiderseits vorhanden (wie das frühlinguistische Amüsement über das Klingelschild des Vaters – auch, wenn niemand sonst an »Doktor Viktor« etwas witzig findet), aber Film und Buch ergänzen sich – trotz meiner Vorbehalte – gegenseitig. Und hierbei ist es auch interessant, dass der deutsche Verleih, der den Film von 2011 in die Kinos bringt, der Kairo Filmverleih – aus Göttingen! – ist. Eine irgendwie versöhnliche Geste der späteren, deutschen Heimat, die Frau Klüger näher ist als die Stadt ihrer Kindheit.
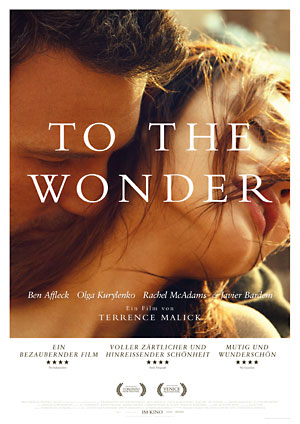 |
To the Wonder
(Terrence Malick)
USA 2012, Buch: Terrence Malick, Kamera: Emmanuel Lubezki, Schnitt: A.J. Edwards, Keith Fraase, Shane Hazen, Christopher Roldan, Mark Yoshikawa, Musik: Hanan Townshend, Production Design: Jack Fisk, Art Direction: David Crank, mit Ben Affleck (Neil), Olga Kurylenko (Marina), Rachel McAdams (Jane), Javier Bardem (Father Quintana), Tatiana Chiline (Tatiana), Romina Mondello (Ann), Tony O'Gans (Sexton), Charles Baker (Carpenter), Marshall Bell (Bob), 112 Min., Kinostart: 30. Mai 2013
In vier Jahrzehnten war Terrence Malick (wie vor ihm nur Stanley Kubrick) der Inbegriff des Regisseurs, der zwar lange auf seine Arbeiten warten ließ (oft genug hat man bei beiden schon die Hoffnung aufgegeben, ein weiteres Werk zu erleben), bei dem sich das Warten aber auch immer lohnte. Zumindest bis The Thin Red Line hätte ich das mit eigenem Blut unterschrieben, doch auch The New World war trotz einiger Mängel immer noch ein überdurchschnittlich intelligenter Film.
Seit Tree of Life gibt es offenbar einen neuen Terrence Malick. Seine nächsten zwei Filme sollen bereits abgedreht sein, abermals mit Starbesetzung. Ich befürchte nur, dass es sich dabei ähnlich wie bei To the Wonder um »Filmpoeme« handelt. Das ist der Begriff, mit dem die für die Promotion zuständigen Agenturen versuchen, die sperrige Art des Geschichtenerzählens innovativ neu zu verpacken und somit zu vermarkten. Mit einem abgeschlossenen Studium der englischen Literatur weiß ich, dass man auch in Gedichtform Geschichten erzählen kann. Eher stringent und in Versform wie bei Geoffrey Chaucer, aber auch eher vage bis assoziativ in der Narration und auf ein herkömmliches Reimschema pfeifend wie bei T.S. Eliots The Waste Land.
Wer sich an Licht und Schweigen delektieren mag, und auch im Kinosaal gern über religiöse Fragen meditiert, der mag diesen Film auch als kleines lyrisches Wunder interpretieren. Meiner Ansicht nach ist jenes fabulöse »Filmpoem« von Klassikern der geschriebenen Lyrik ebenso weit entfernt wie von Filmkunst, selbst solcher, die sich von den Fesseln der Narration befreit. Denn selbst die hübsch anzuschauenden Bilder des Kameramannes Emmanuel Lubezki (und die fotogenen Darsteller) können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wenige, was hier an Narration übermittelt wird (und man muss es sich mühsam zusammenklauben), kaum den Stoff für zweieinhalb Limericks hergeben würde.
Ben Affleck mag der Liebling der aktuellen Oscar-Saison sein – von seinen darstellerischen Fähigkeiten bin ich nach wie vor nicht überzeugt. Und Regisseur Malick hält sich beim Vertrauen darauf auch eher zurück und lässt den Mimen größtenteils im Wechsel böse oder verliebt dreinschauen. Im weitesten Sinne auch so eine Art Reimschema.
Natürlich geht es in To the Wonder wieder um die großen Themen, für weniger macht's der studierte Philosoph Malick nicht. Das Wunder der Liebe muss sich gegen den Alltag als Zugezogene bewähren.
Das US-französische Liebespaar Neil (Ben Affleck) und Marina (Bond-Girl Olga Kurylenko, clevererweise auch in ihrer Rolle mit Migrationshintergrund ausgestattet) darf zunächst jeweils auf dem »Heimatgrund« den etwas verquasten voice-over-Kommentar liefern (vor laufender Kamera schweigt man lieber), ehe man dann gemeinsam mit Marinas zehnjähriger Tochter in Oklahoma landet, wo sich die Probleme schnell abzeichnen. Am Rand geht es auch mal um Neils Job bei der Baubehörde, um Giftstoffe und Kinder (kaum, dass man Interesse für das Thema aufgebracht hat, vergisst es der Film bereits wieder größtenteils) – oder um einen anderen Expat, Javier Bardem als Geistlichen, der das Heucheln satt ist und in der Glaubenskrise (die mich ähnlich im Kinosessel befiel) ebenfalls auf ein Wunder (oder zumindest ein dergestalt zu deutendes Zeichen) lauert. Doch das Wunder der Liebe zeigt sich zwischenzeitig flatterhaft, wenn Neil auf eine alte Freundin (Rachel McAdams) trifft, was der Geschichte vielleicht so was wie Spannung verleihen soll.
Aus meiner Sicht waren die spannendsten Momente des Films die Einsätze von Schwarzblenden und klassischer Musik (der reichlich pathetische Parsifal > vernachlässigter Interpretationsansatz). Die Dialoge hingegen waren oft hölzern bis peinlich, und dass für die Montage nicht weniger als fünf Personen (Malick nicht mitgezählt) zuständig waren (offenbar spielte ursprünglich auch Rachel Weisz in dem Film mit, landete aber auf dem sprichwörtlichen Boden des Schneideraums), all dies zeugt nicht unbedingt davon, dass Malicks »Fließbandtätigkeit« dem Material nutzt. Vielleicht werden die nächsten Filme Malicks mich Lügen strafen, aber zumindest dürfte der Erwartungsdruck jetzt abnehmen.
 |
Canim Kreuzberg
(Asli Özarslan, Canan Turan)
50 Min., Kinostart (zumindest im Berliner Kino Moviemento): 23. Mai 2013
Canim Kreuzberg ist ein Omnibus-Film ähnlich wie Kreuzkölln. Zwei Filme mit nur grenzwertig kinotauglicher Länge und einer vagen, regional bedingten, thematischen Verbindung, werden zusammen ins Kino gebracht, sozusagen als kurzes Double Feature (bei Kreuzkölln waren die Einzelteile immerhin zusammen 89 Minuten lang also das, was man landläufig »abendfüllend« nennt – 2 mal 25 Minuten sind meines Erachtens auch zusammenaddiert noch sehr grenzwertig, weil man in den meistens Kinos ab 121 Minuten auf Überlängenzuschlag besteht, bei auffällig kurzen Werken – sagen wir mal: unter 75 Min – aber kein Kinobetreiber auf die Idee kommen würde, einen Unterlängenrabatt zu gewähren ...).
Meine Meinung zu den beiden Filmen möchte ich ungeachtet der verwertungstechnischen Zwangsehe aber bitteschön getrennt äußern. Für die Stabangaben zählt: Sonderzeichen der türkischen Sprache (wie das i ohne Punkt in Kiymet) wurden aus logistischen Gründen »eingedeutscht«, was man mir verzeihen mag.
Bastarde (Asli Özarslan)
Deutschland 2011, Buch: Asli Özarslan, Kamera: Ebru Tuncbilek, Benny Kaya, Florian Wentsch, mit Tuncay Kulaoglu, Sermin Langhoff, Neco Celik, Nurkan Erpulat, 25 Min.
Streng genommen lautet der Titel dieses Films: »Bastarde. Postmigrantisches Theater Ballhaus Naunynstraße«. Doch da der Omnibusfilm ohnehin schon so ein kompliziertes Gebilde ist, will man die Journalisten schonen, die schon einen Spagat machen müssen, um zwei doch recht unterschiedliche Nicht-mal-Halbstünder unter einen Hut bekommen müssen. In typisch dokumentarischen Interview-Situationen, angereichert durch einige Szenen aus den aufgeführten Theaterstücken, wird das »postmigrante« Theater vorgestellt. So wie der unklare Begriff »postmigrantisch« vor allem ein Gespräch entfachen soll, ist auch das Erkennungszeichen der »Bastarde«, der gefährlich dreinblickende Kopf eines schwarzen Straßenköters, eine gewollte Provokation, ein Aufmerksamkeitserreger. Und mit solchen Spielerein spielt man gern in der Naunynstraße. Dass die Stücke in deutscher Sprache vorgeführt werden, steht nicht in der Programmbroschüre, man erwartet auch vom Publikum einen »Leap of Faith«, der aber belohnt wird, zumeist mit (im weitesten Sinne) Komödien, die als »Überlebungsstrategie« aufgefasst werden. Hin und wieder ein gewollter Grammatikfehler, das ist ein Klischee wie die Akzente mancher Darsteller. Als Zuschauer muss man dann erst begreifen, dass der, der mit Akzent spricht, nicht auch mit Akzent denkt. Klischees sind ein wichtiges Thema. Sätze wie »Bist du schwul oder bist du Türke?« rufen ins Bewusstsein, dass manches nur im »Klischee der großen Gemeinschaft« unvereinbar wirkt.
Sehr zu Herzen geht auch das Lied »Gastarbeiter« mit Textzeilen wie »Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an«. Immer wieder vermeintliche Widersprüche, die aus Vorurteilen zehren, oft bis ins Absurde übertrieben wie die »Gebärmaschine«, deren Kinder alle bereits mit Schnurrbart oder Kopftuch geboren werden, um dann in ihren »Almanci«-Tieschörts gemeinsam die inoffizielle Nationalhymne »Wir lieben deutsche Land« zu intonieren. Ein Film, der gerne auch doppelte oder dreifache Lauflänge hätte haben können.
Kiymet (Canan Turan)
Deutschland 2012, Buch & Schnitt: Canan Turan, Kamera: Canan Turan, Adriana Uribe, Duygu Saykan, Mustafa Yelekli, Musik: Uran Apak, mit Kiymet Özdemir, Canan Turan u. v. a., 25 Min.
Kiymet ist vor allem eine Liebeserklärung der Filmemacherin an ihre Großmutter. Der Film beginnt mit einer – für meine Verhältnisse – etwas zu melodischen Voice-over-Stimme, die die Narration begleitet. Die Dokumentarfilmerin, die während des Films seltsam im Hintergrund bleibt (ich persönlich hätte beispielsweise gern erfahren, ob ihr Tinkerbell-T-Shirt mit Regenbogenfarben auch von einer unangepassten Lebensart zeugt, doch das war so ein Element des Films, das man höchstens »zwischen den Zeilen« aufpicken konnte) erklärt die Situation: Großmutter Kiymet (wenn man das i ohne I-Punkt schreibt, entspricht das türkische Wort dem deutschen Begriff »Wert«) war einst (vor drei Generationen) die erste Person aus der Familie, die nach Deutschland immigrierte, kehrte dann jedoch in das Dorf an der griechisch-türkischen Grenze zurück, wo die kleine Filmcrew sie jetzt besucht und nebenbei das Frühlingsfest Hidrallez beobachtet, wo ältere Mütterchen über ein Feuer springen – wie eine visuelle Entsprechung der Geschichte.
Nebenbei wird mit Interviews, Erinnerungen und auch ein paar Archivaufnahmen von der Zeit in Deutschland berichtet. Wie der »Opa« Ahmet nachkam nach Berlin, quasi sofort mit Jugoslawinnen zu flirten begann und der Oma den Seelenfrieden raubte. In den 1960ern, als durch das Wirtschaftswunder Arbeitslosigkeit kein Problem war, wurden die ersten Gastarbeiter ganz konkret von Deutschland eingeladen, auch Kiymet hatte bereits nach zwei Tagen eine Arbeitsstelle. Doch als Ahmet (der sich zudem durch Alkoholzuspruch und fehlender finanzieller Beteiligung am Haushalt auszeichnet) ein Verhältnis mit der Tochter von Kiymets Bruder (also ihrer und irgendwie auch seiner Nichte) beginnt und schließlich die Duldung durch seine Gattin mit Waffengewalt zu erzwingen versucht, trennt sich Kiymet von ihm und kehrt zurück in ihr Heimatdorf.
»Wenn er dich nicht schätzt, solltest du ihn auch nicht schätzen«, so das Resümee der nach der Trennung viel entspannteren exemplarischen »Urmutter« einer Kreuzberger Migrantenfamilie.
Bei der filmisch offenbar obligaten Rückkehr Kiymets nach Kreuzberg wird augenblicklich aus der »Babanem Dede« wieder die »Oma«, der Film sucht »closure« oder ein Fazit (»Deutschland ist nicht meine Heimat, aber Kreuzberg«), doch trotz ambitionierter Absichten, trotz Gedichten und untertiteltem Liedgut bleibt der Blick auf die komplexe Familiengeschichte doch ein sehr fragmentarischer, wobei ich mir nicht sicher bin, ob hier mehr Material zu mehr Tiefe geführt hätte oder die interessanteren Elemente des Films noch stärker versandet wären. Das innewohnende Drama hätte irgendwie besser herausgearbeitet werden, in weniger als einer halben Stunde versucht der Film seine Themen von ca. fünf verschiedenen Seiten aufzurollen, erreicht aber kaum einmal einen überzeugenden Teilaspekt.
Sehr interessant ist übrigens auch, wie das Presseheft versucht, die reichlich unterschiedlichen Filme über eine ökonomische Zwangsehe hinaus zu einem geschlossenen Ganzen zu verbinden. Es bleibt aber beim Versuch.
Die Jungfrau, die Kopten und ich (Namir Abdel Messeeh), Papadopoulos & Söhne (Markus Markou), 7 Tage in Havanna (Laurent Cantet, Benicio del Toro, Julio Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabio, Pablo Trapero) und andere »Sommerstarts«.
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 98:
98: