| |
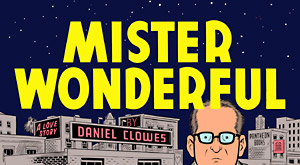
Daniel Clowes: Mister Wonderful
Pantheon Books 2011
80 Seiten, $ 19.95
» Verlag
» amazon

Chester Brown: Paying for it
A Comic-Strip Memoir about Being a John
Drawn & Quarterly 2011
292 Seiten, $ 24.95
» Verlag
» amazon
|
Mister Wonderful
& Paying for it
Innerhalb ihrer Generation dürften Daniel Clowes und Chester Brown abgesehen von Los Bros Hernandez die langfristig angesehensten Independent-Comickünstler des nordamerikanischen Kontinents sein. Beide blicken inzwischen auf ein Vierteljahrhundert Mitwirkung an der Weltcomicgeschichte zurück und seit den ersten Lloyd Llewellyn- und Yummy Fur-Heften konnten sie ihren Zeichenstil sowie ihre ganz persönlichen Vorlieben immer weiter ausarbeiten, aus den etwas unscheinbaren Rohdiamanten sind längst Edelsteine geworden, die jeder, der sich halbwegs ernsthaft mit Comics beschäftigt (und über das Marvel-Fanboy-Dasein hinausgewachsen ist), beachten sollte.
In beiden Fällen zeigt sich aber auch, dass man nur in den günstigsten Sonderfällen als Comiczeichner, der sich nicht irgendwelchen Marktbewegungen unterordnet, mit dieser Kunst auch ein Mittelklasseleben bestreiten kann.
Daniel Clowes hatte immerhin das Glück, dass zwei seiner Schöpfungen es zu gelungenen Filmadaptionen brachten, bei denen er als Drehbuchautor auch weitgehend beteiligt war, und deren (teilweise sehr kurzfristigen) Ruhm er jeweils mit Tie-In-Publikationen zu zusätzlichen Einnahmen nutzen konnte. Ghost World bekommt man seit neuestem endlich auch in Deutschland als DVD mit englischer Originalfassung (Superstar Scarlett Johannsson läuft hier in einer frühen Rolle in ziemlich »kinky« Klamotten herum). Doch Art School Confidential, eine der amüsantesten fünf Comic-Verfilmungen aller Zeiten (ungeachtet des Details, dass die Comicvorlage nur aus sechs oder acht Seiten bestand), kam hierzulande nicht einmal regulär in die Kinos (lief aber immerhin auf dem Filmfest München), und entsprechend weiß kaum jemand von der Existenz des Films.
Chester Brown hat streng genommen eigentlich keine Chance, dass seine Comics jemals verfilmt werden. Weder seine sehr persönlichen autobiographischen Werke (I Never Liked You oder The Playboy), noch sein abgedrehtes Frühwerk Ed the Happy Clown (noch am ehesten als Zeichentrickfilm denkbar, dann aber wahrscheinlich in Schwarzweiß und ab 18), seine Adaptionen von Teilen des neuen Testaments aus Yummy Fur (Matthew), oder Louis Riel, sein letztes größeres Werk, über eine außerhalb von Kanada kaum bekannte historische Persönlichkeit, die sich nicht eben für ein Hollywood-Biopic eignet. Und sein unvollendetes Projekt Underwater (ich bin immer noch stolz auf meinen Leserbrief in Heft 2) würde verfilmt wahrscheinlich Gaspar Noés Enter the Void verblassen lassen wie eine Energiesparlampe.
Die beiden neuesten Comics von Clowes und Brown nutzen einige Möglichkeiten des Mediums auf raffinierte Weise, und erstaunlicherweise lässt sich daran auch die Verfilmbarkeit (oder das Fehlen davon) ziemlich einfach ableiten (und an dieser Stelle will ich nur kurz klarstellen, dass die »Verfilmbarkeit« eines Comics - oder das Fehlen davon - keineswegs als Qualitätsaussage über einen Comic missverstanden werden sollte).
Daniel Clowes’ Mister Wonderful erschien zunächst im New York Times Magazine und wurde für die Buchpublikation noch bearbeitet und ergänzt. Besonders auffällig sind hierbei die im ungewöhnlichen Querformat fast regelmäßig auftauchen Splashpages (eigentlich Doppelseiten), die die Atmosphäre des Comics um viele Ebenen bereichern (und ich gehe jetzt mal ganz ignorant davon aus, dass es diese Seiten bei der Erstveröffentlichung noch nicht gab). Dass plötzlich der Titel des Werks sich über eine Doppelseite erstreckt, das gab es auch schon bei Chris Ware oder Ralf König und es wirkt natürlich sehr filmisch, wie ein Vorspann (bei König findet man diese Parallele sehr ausformuliert). Aber Clowes nutzt diese Möglichkeit für ganz unterschiedliche Momente ...
Zwischendurch mal kurz ein paar Sätze zur Story. Aus der Sicht des ca. 40jährigen Marshall beschreibt Mister Wonderful ein Blind Date mit etwas Nachgeschichte. Auf dem Buchrücken benutzt Clowes die Bezeichnung »Midlife Romance«, und wenn man mutig ist, könnte man das Buch als Romantic Comedy umschreiben. Aber eben eine RomCom von Daniel Clowes, was comicspezifisch etwa das Äquivalent eines Films in diesem Genre wäre, wenn ihn Todd Solondz oder Paul Thomas Anderson (Punch-Drunk Love) geschrieben und inszeniert hätte. Zurück zu den Splash-Pages.
Nachdem Marshall einige Zeit auf das Eintreffen (bzw. Erkennen) von Natalie wartet, ist der erste große Splash-Page-Moment sein aufgerissenes Augenpaar (natürlich trägt er eine Brille) mit der dezenten Caption »Oh my God, oh my God, oh my God!« Wer es zu diesem Zeitpunkt noch nicht beim Lesen kapiert hat: die bisherige Geschichte dreht sich vor allem um die unnatürliche Erwartungshaltung bei so einem Blind Date, und wie man Marshalls innerem Monolog sehr gut entnehmen kann, führt dies schnell zu neurotischen Selbstzweifeln. Da ist so ein »Oh my God«-Cliffhanger natürlich wie geschaffen, um den Adrenalinschub auch auf den Leser auszuweiten.
Ähnlich verwendet Clowes die Splash-Page später, wenn Natalie sich (vorerst) wieder aus der Gesellschaft Marshalls zurückzieht. Allein bleibt er als streichholzgroßes Männchen zurück in einer pechschwarzen Nachtszene, die ihn nicht nur visuell erschlägt, sondern natürlich auch seinen Gemütszustand darstellt. Die eine Zentralperspektive andeutenden Objekte in dieser Schwärze sind größtenteils erleuchtete Fenster in einem sehr eingeschränkten Farbspektrum, was die Niedergeschlagenheit und Orientierungslosigkeit unterstreicht, aber dennoch einige hoffnungsvolle Farbtupfer setzt.
Meine drittliebste Splashpage nimmt zwei dieser vier Farben wieder auf (das herabgesetzte Pastellgelb als Hintergrund und das etwas matte Rot als zweite Farbe, die Blautöne werden verbannt), nachdem Natalie Marshall fragt, ob er mit auf eine Party gehen möchte. Dann folgt nur ein langgezogenes Soundword (»BRRRRMRRRBLLBRRRRR«, Clowes war schon häufig bei Comicpreisen als bester Letterer nominiert, und hier sieht man mal wieder warum), das dann auf der nächsten Seite bei der gemeinsamen Autofahrt (immerhin eine vielversprechende »Intimität«) aufgenommen wird.
Soviel zu den Splash-Pages. Das eingangs erwähnte Stilmittel, das man in ähnlicher Form auch in Chester Browns Paying for it wiederfinden kann, ist aber ein gänzlich anderes. Marshalls innere Monologe hatte ich schon erwähnt. Diese Captions (wie »Oh my God!«) begleiten die gesamte Geschichte und verdeutlichen Marshalls Gedankengänge. Hierbei ist aber auffällig, dass Marshalls Gedanken seine Wahrnehmung der Außenwelt einschränken, was visuell dadurch umgesetzt wird, dass die Captions sich oft räumlich vor den Sprechblasen befinden, die dadurch in ihrer Lesbarkeit beschnitten werden. Was die subjektive Erfahrung für den Leser nachvollziehbar macht.

Abgesehen davon spielt Clowes wie schon in Wilson und Ice Haven wieder mit unterschiedlichen Comicerzählformen, streut zwischendurch wieder kleine Cartoonstreifen mit vereinfachten, kindlichen Versionen der Protagonisten ein (à la Peanuts oder Sugar & Spike), die für sich betrachtet, simpler wirken, in der Wechselwirkung mit der Haupthandlung (oft handelt es sich um kleine Fantasien) aber die Komplexität steigern.
Mister Wonderful ist ein weiteres vollendetes Hauptwerk in Clowes Bibliographie, um einen weiteren Filmvergleich zu bemühen, Clowes dürfte momentan auf einem Höhepunkt seines Schaffens sein wie Woody Allen zu Zeiten von Manhattan oder Stardust Memories. Hoffen wir nur, dass er weiterhin noch jedes mal eine klitzekleine Spur besser wird und den Leser nicht irgendwann mit Variationen ähnlicher Themen langsam verliert.
Nun zu Chester Brown, der sich von Clowes in vielen Details unterscheidet, zum Beispiel darin, dass er sich größtenteils dem (auch Auto-)Biografischen verschrieben hat und wenig bis kein Interesse für Farbe hat (abgesehen von dem einen von Brown getuschten 1963-Heft und einigen Covern und Einzelseiten gibt es keine kolorierten Brown-Seiten).
Paying for it trägt den Untertitel »a comic-strip memoir about being a john« und bereits ohne einen Einblick in das Werk fühlt man sich animiert, seine Erlebnisse als Freier als eine Art »Fortsetzung« zu seinen Erfahrungen als Playboy-Leser (The Playboy) zu sehen. Und im Vergleich dieser beiden Werke ergeben sich auch viele interessante Ansatzpunkte. Am lapidarsten ist hierbei wohl das kleine Detail, dass Brown bei einem Auftritt von Alley Baggett bei einer Comic Convention seine Freunde und Zeichnerkollegen Seth und Joe Matt darüber aufklärt, dass diese gar nicht - wie angepriesen - ein Playmate ist, sondern nur nackt im Playboy abgebildet wurde, was ein nach wie vor detailliertes Wissen über die Publikation impliziert.
In The Playboy erfuhr der Leser unter anderem, dass der jugendliche Chester bei dunkelhäutigen Playmates nicht das gewünschte Resultat erzielte, in Paying for it geht der Künstler politisch korrekt vor und klärt zu Beginn, dass die dargestellten Prostituierten nicht allesamt Kaukasierinnen mit dunklen Haaren sind, er sie aber zu ihrem Schutz recht gleichförmig dargestellt hat und jeweils mit Tarnnamen versehen hat. Hier würde ich doch gerne mal nachhaken, ob Chet seinen früheren Erregungsrassismus abgelegt hat (bekannterweise hatte er ja längere Zeit eine asiatisch-stämmige Freundin), oder er nur das Thema geschickt umschifft hat.
Das Problem der Identitäten der dargestellten Personen ist in Autobiographien immer eine heikle Angelegenheit, wie ich aus eigener Erfahrung (HAMAIBSGW) bestätigen kann. Brown erklärt zwar im Verlauf des Buches, dass er auf speziellen Internet-Profilen »Konsumenten-Bewertungen« zu ihm besuchten Damen verfasste, doch da sein Buch eine potentiell gänzlich andere Leserschaft anspreche, hat er sämtliche im Buch auftauchende Person dermaßen anonymisiert, dass es für den Leser nicht immer einfach ist, den Überblick zu behalten (leider ein Problem, das mir bei meinen bescheidenen Gehversuchen im Metier auch nicht erspart blieb). Und so begleiten wir Chester bei seinen Erst- und Wiederholungsbesuchen, und schon die Kapitelüberschriften verdeutlichen die vorhersehbare Verwirrung (2: »Carla«, 3: »Angelina«, 4: »Anne«, 5: »Back to Angelina«, 6: »Back to Anne«, 7: »Amanda«, 8: »Back to Anne«, 9: »Susan«, 10: »Back to Anne« undsoweiter). Die Kapitel rangieren dabei zwischen diversen Seiten und manchmal drei bis fünf Panels (»No tip for this one«, »not as good sexually«), wobei das Abrutschen in eine Art von Sexismus nicht zu verhindern ist.
Ein weiteres Problem des Buches sind Browns politische Absichten. Es ist unübersehbar, dass er neben einem über Jahre angesammelten Kreis von Stammlesern auch diesmal (wie schon bei Louis Riel) darüber hinaus Leser ansprechen will, die sich weniger für die Kunstform Comic als die Thematik interessieren (eine der besuchten Damen äußert sich »Das würde ich lesen wollen«, neben dem Vorwort von Robert Crumb und einigen Klappentext-Lobhudeleien von Moore oder Gaiman äußern sich auch Sexarbeiterinnen, Soziologen und Psychologen positiv zu dem Werk). Und so wird Paying for it ein klein wenig zu einem Politikum. Was an sich ja nicht negativ ist. Doch die Repräsentation von politischen Diskussionen geht nicht unbedingt Hand in Hand mit dem Streben nach größtmöglicher Genauigkeit bei einem autobiographischen Werk. Über seine bezahlten Schäferstündchen hat Brown offensichtlich Buch geführt (das erste Kapitel des Buches erklärt das ganze Werk eigentlich auch als eine Art Selbstversuch), bei seinen Diskussionen mit Freunden und Exfreundinnen hingegen ging er weniger akribisch vor, und trotz seiner Erläuterungen im nicht eben schmalen Textteil im Anschluss an den eigentlichen Comic wirkt hier einiges fragwürdig. Abgesehen von den letzten paar Kapiteln fällt so beispielsweise auf, dass Browns Argumente immer weitaus durchdachter wirken als die seiner Gesprächsteilnehmer. Diese Tendenz ist auch im Textteil am Schluss des Buches wiedererkennbar. Wobei Brown aber eigentlich gar nicht überdeutlich zu Fragen der kanadischen Gesetzeslage betreffend der Prostitution Stellung beziehen will, sondern es ihm vor allem um die Dekonstruktion des oft als gegeben akzeptierten Ideals der romantischen Liebe geht. Wobei er hier aber eingesteht, dass er die mittelalterlichen Quellen auch mehr vom Hörensagen kennt. Kurzum, das Buch ist teilweise auch ein Sammelsurium von ungleichmäßig ausdiskutierten Themen im Zusammenhang mit Prostitution und Chester Browns etwas unkonventioneller Auslegung seines Sexuallebens (man will ja nicht schon alles spoilern). Ungeachtet meiner Kritikpunkte ist Paying for it aber definitiv lesenswert, egal ob als Vertreter des Mediums Comic oder als Beitrag zur fortlaufenden Diskussion über Prostitution und ihre gesetzlichen und gesellschaftlichen Probleme.
Nach diesem ganzen Gesülze aber noch was zum Comic an sich. So wie Daniel Clowes die Sprechblasen hinter den Captions versteckt, verbirgt Chester Brown die Gesichter der anonymisierten Huren oftmals hinter Sprechblasen, was ebenfalls ein klarer Bruch gegenüber den über Jahrzehnten entwickelten »Spielregeln« des Comics ist. Sicher hätte er auch schwarze Balken oder ähnliches benutzen können, doch diese hätten nur auf sich selbst aufmerksam gemacht, während Browns Lösung oft unauffälliger ist und für den Leser oft auch interessant. Ähnlich wie in manchen Filmen auftauchende nackte Personen, deren Schambereiche jeweils geschickt durch Blumenvasen o. ä. verdeckt werden.

Rein zeichnerisch ist Brown auf der Höhe seiner Kunst, es ist hierbei aber ein wenig schade, dass die Panels im Buch so klein (4,5 x 3 cm) reproduziert werden. Man ist fast versucht, eine Lupe herauszunehmen, um sich an seiner detaillierten Schraffurtechnik zu erfreuen.
Paying for it hat so seine kleinen Macken, bei denen man als Leser nachhaken sollte. Doch das zeichnet das Buch auf seine Art auch aus. Schon jetzt ein Klassiker und wahrscheinlich schnell das Werk, das man im Zusammenhang mit Brown als erstes nennen wird. Vielleicht so etwas wie Dogville für Lars von Trier.



