
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
2. Oktober 2013 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||||

|
|
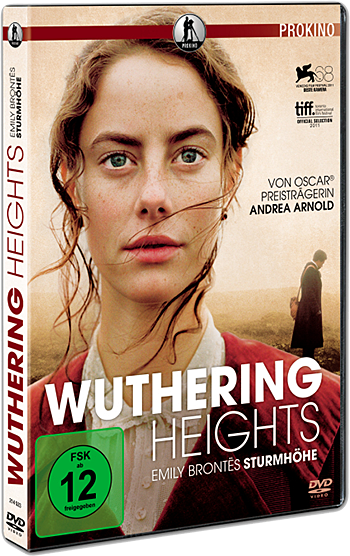  |
Wuthering Heights
(Andrea Arnold)
UK 2011, Buch: Olivia Hetreed, Andrea Arnold, Lit. Vorlage: Emily Brontë, Kamera: Robbie Ryan, Schnitt: Nicolas Chaudeurge, Songs: Shannon Beer, Kostüme: Steven Noble, mit Solomon Glave (Young Heathcliff), James Howson (Older Heathcliff), Shannon Beer (Young Cathy), Kaya Scodelario (Older Cathy), James Northcote (Edgar Linton), Lee Shaw (Hindley), Simone Jackson (Nelly), Nichola Burley (Isabella Linton), Paul Hilton (Mr. Earnshaw), Amy Wren (Frances), Steve Evets (Joseph), Oliver Milburn (Mr. Linton), Oliver Powell (Young Edgar), Eve Coverley (Young Isabella), Michael Hughes (Hareton), Emma Ropner (Mrs. Linton), 123 Min.
Eigentlich schwer nachvollziehbar, dass Andrea Arnolds Red Road einst, als noch niemand dieses Regietalent kannte, einen deutschen Kinoverleih fand, während ihre ambitionierte Literaturverfilmung, die immerhin einige Leser des Klassikers (und all die Kinoenthusiasten, die spätestens seit Fish Tank auf Arnold aufmerksam geworden sein müssten) in die Filmtheater hätte locken müssen, hierzulande nur auf DVD herauskam.
Sie modernisiert die bekannte, leidenschaftliche Brontë-Geschichte um Heathcliff und Catherine vor allem sprachlich (um die Gefühlswelt der ungestümen Liebenden einem heutigen Publikum nahezubringen, dürfen die Figuren auch mal fluchen wie auf einem nicht ganz so feinen Schulhof unserer Zeit), streicht die komplette Rahmenhandlung und macht aus der Erzählerfigur Nelly eher einen Katalysator am Rande. Mehr als die Hälfte des Films dreht sich um die gemeinsam heranwachsenden Teenager (Solomon Glave, Shannon Beer), wobei sich die Erzählperspektive subtil Heathcliff zuwendet.
Wo eine Schwäche des Buches wohl die sorgsam konstruierte Quasi-Wiederholung der Geschichte in der Folgegeneration ist, kappen Arnold und ihre federführende Mitautorin Olivia Hetreed sozusagen die »Zukunft« und konzentrieren sich stattdessen auf eine viele Naturmomente »rezitierende« Flashback-Ebene, die Heathcliffs Gefühlswelt in leidenschaftliche cinematische Momente umsetzt. Hierbei wird die allzu akkurate Reihenfolge bestimmter Ereignisse bei Brontë (erst heiraten, dann …) zu keinem Zeitpunkt zerstört, aber mitunter etwas anders suggeriert. Wirklich großartig wird der Film zum Schluss, wenn Heathcliff etwa das Grab Cathys öffnen will (schon zuvor gab es eine fast nekrophile Szene, die im Buch allenfalls durch das symbolische Verflechten zweier Haarlocken angedeutet wurde), dabei aber versagt (auch, weil dies nur eine Wiederholung der anderen Szene wäre) und sich stattdessen daran erinnert, wie er einst mit Cathy ein halbwegs harmloses »Schlammringen« veranstaltete. Als Nonplusultra der Leidenschaft gehen in diesem Film Schläge oder Haareausreißen durch, und das versöhnliche, aber umständliche Happy End des Buches wird hier durch einen Akt der Tierquälerei ersetzt. Arnold zeigt Heathcliff schon in jungen Jahren dabei, wie er gefangenen Kaninchen das Genick bricht. Um seine Frustration zu demonstrieren, wenn er später »aus Rache« die Nachbarstochter Isabella ehelicht, hängt er ihr domestiziertes Schoßhündchen am Halsband an einen Zaun (wahrscheinlich alles von Tierschützern abgesegnet, aber das Bild, wie die gestriegelte Töle im verregneten Sturmwind »flattert«, bleibt schon im Gedächtnis). Hareton, der Sohn des verhassten Stiefbruders Hindley, der im Buch an Heathcliffs Stelle zum Ende etwas Liebe erfährt, zeigt in der Verfilmung die Verbindung zu Heathcliff (der im Film im Gegensatz zum Buch nicht der Ziehvater des Jungen wird), indem der trotz Elternhaus verwahrloste Knabe ebenfalls einen Hund so aufknüpft. Diese kleinen Momente zeigen erneut die Meisterschaft der Regisseurin, wo das gemächliche Erzähltempo in der ersten Hälfte des Films zunächst nicht völlig überzeugt, aber durch die späteren Flashbacks und das Anziehen des Tempos (im Roman gänzlich anders akzentuiert) dann umso durchdachter wirkt.
Mein einziger Kritikpunkt ist, dass Kaya Scodelario, die Darstellerin der älteren Cathy (im Buch heißt sie Cathleen, die Existenz einer Tochter Cathy wird allenfalls mal vage angedeutet), zwar den Top-Credit im Nachspann bekommt, obwohl sie in Sachen Screentime wahrscheinlich so auf Platz 5 oder 6 rangieren würde – ich mir aber tatsächlich mehr Zeit mit dieser wunderschönen und durchaus nicht unbegabten jungen Frau gewünscht hätte. Wäre aber angesichts der Romanvorlage und Streichung in der Adaption keinesfalls zu verantworten gewesen. Und wenn die einzige Kritik eine unerfüllte kleine Schwärmerei ist, dann gibt es eigentlich gar keinen Kritikpunkt. Nur den dritten großartigen Film einer nicht angemessen gefeierten Regisseurin in Folge.
 Bildmaterial © 2013 WARNER BROS.  |
Gravity
(Alfonso Cuarón)
USA / UK 2013, Buch: Alfonso Cuarón, Jonás Cuarón, Kamera: Emmanuel Lubezki, Schnitt: Alfonso Cuarón, Mark Sanger, Musik: Steven Price, mit Sandra Bullock (Dr. Ryan Stone), George Clooney (Matt Kowalsky), Ed Harris (Stimme »Mission Control«), Eric Michels (Stimme »NASA«), Basher Savage (Stimme »Space Station Captain«), 90 Min., Kinostart: 3. Oktober 2013
Wie Alfred Hitchcocks Lifeboat oder Carl Schenkels Abwärts mit ähnlich klaustrophobischen Überlebensgeschichten ihre Zeit und das Kino dieser Zeit spiegelten, so ist Gravity ein Spiegel der heutigen Möglichkeiten, ein Hi-Tech-Kammerspiel ohne Kammer.
Alfonso Cuarón ist ein Regisseur, der es selbst in einem Harry-Potter-Film noch schafft, seine persönliche Handschrift durchscheinen zu lassen, und den man aktuell ohne Probleme als den besten Mainstream-Regisseur bezeichnen kann (er nutzt die technischen Möglichkeiten mit einer Souveränität, von der James Cameron oder Steven Spielberg mittlerweile weit entfernt sind – und hat nebenbei noch etwas zu sagen und konzentriert sich nicht nur auf seinen Unterhaltungsauftrag).
Hier erzählt er eine eigentlich kleine Geschichte mit viel technischem Bombast (verglichen mit den 3D-Effekten hier war Life of Pi ein B-Movie) und einer selbstbewussten (aber angemessenen) Angeberei, wie wir sie schon in Children of Men bewundern konnten. Sein liebstes Mittel dafür ist abermals die Plansequenz. Früher einmal war die Plansequenz eine kostenaufwendige Spielerei, die sich nur wenige Regisseure »leisten« konnten. Alfred Hitchcock, Orson Welles, Brian De Palma, Robert Altman. Heutzutage ist es kein Problem, einen kompletten Film wie eine lange Einstellung ohne einen Schnitt erscheinen zu lassen, die Gefahr, das dass schnell sehr Prätentiös wirkt und die Geschichte des Films darunter leidet, ist aber sehr groß. Cuarón löst das Problem wie folgt: Etwa die ersten zwanzig bis dreißig Minuten des Films gibt es keinen Schnitt (keinen sichtbaren Schnitt, natürlich wurden hier unzählige Einzeleinstellungen und CGI-Effekte einfach zusammengefügt). Drei Astronauten agieren in der Schwerelosigkeit des Alls, in unmittelbarer Nähe einer Raumstation. Dr. Ryan Stone (Sandra Bullock) ist hierbei eine extra beorderte Expertin, der die Erfahrung fehlt und die auch eher »gemischte Gefühle« angesichts ihrer Tätigkeit hat (vergleiche Howard Wolowitz). Ihre beiden Kollegen feixen eher herum und erzählen sich Anekdoten, während sie versucht, ihren Job schnell zu erledigen, um möglichst bald wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Matt Kowalsky (George Clooney) muss man allerdings zu Gute halten, dass er ein echter »Professional« ist, so wie Niki Lauda (der naheliegende Vergleich) weiß er genau, wie man die verschiedenen Gefährte zu handhaben hat, ob die Düsen seines Raumanzugs oder die amerikanischen, russischen oder gar chinesischen Raumfahrzeuge.
Nachdem zunächst alles glatt läuft und der Zuschauer sich gemeinsam mit den Akteuren an der schönen Aussicht sattsehen kann, kommt es dann zur Krise, wie man es beispielsweise aus Apollo 13 kennt (Ed Harris liefert in Gravity eine Stimme). Im Gegensatz zu diesem Film (oder Rush) geht es hier aber um eine fiktive Geschichte, man weiß also nur vorher, was passiert, wenn man so blöd ist, sich den Film durch Spoiler verderben zu lassen (wird hier nicht passieren). Cuarón (der auch das Drehbuch mit seinem Bruder zusammen schrieb) kann die Geschichte so dramatisch machen, wie er will. Und er kann auch das Seelenleben seiner Astronauten ausleuchten, so weit er möchte. Dies ist ein großes Potenzial des Films, das aber auch Gefahren birgt. Sagen wir es mal so: Cuarón liefert einige großartige Momente, aber hier oder da hätte man sich andere Entscheidungen gewünscht.
Die großartigste Entscheidung des Films ist aber, dass Cuarón sich nach seiner Angeber-Sequenz zu Beginn loslöst vom Machbaren und stattdessen die Geschichte in den Mittelgrund stellt. Im ganzen Film gibt es vielleicht 25 sichtbare Schnitte, doch wenn in einer Situation entweder eine komplizierte Kameradrehung nötig war oder ein simpler Gegenschnitt, dann hat sich Cuarón zumeist richtig entschieden. Der Angeberfaktor ist schon recht hoch (es macht aber Spaß, dieser Angeberei beizuwohnen), aber wenn die Filmsprache und das Seherlebnis auf lange Sicht unter dem Beharren auf das »Machbare« leiden würde, dann gibt es halt einen Schnitt, man muss sich ja nicht für etwas schämen, was das Herz des Mediums Film ist.
Clooney sagt schon sehr früh im Film mal zu Bullock: »You're the genius up here, I'm only driving the bus.«, und im Grunde ähnelt Gravity auch ein wenig Speed (eine andere physikalische Größe), nur, dass man hier keinen Bösewicht wie Dennis Hopper braucht, sondern die unwirtliche Umgebung selbst der tödliche Feind ist. Mal eben an den Straßenrand fahren geht hier nicht.
Zu Zeiten von Stanley Kubricks 2001 – A Space Odyssey hieß es, dass man, um einen realistischeren Weltraumfilm zu drehen, wohl »on location« gehen müsse. Gravity beweist, dass es auch im Studio geht, wobei »realistisch« sich aber vor allem auf die Sinneserfahrungen bezieht, weniger auf die hin und wieder auftauchenden Logikprobleme. Dennoch vermutlich der einzige 3D-Film dieses Jahres, der wirklich was daraus macht.
 Bildmaterial © Universum Film  |
Rush
Alles für den Sieg
(Ron Howard)
Originaltitel: Rush, USA / Deutschland / UK 2013, Buch: Peter Morgan, Kamera: Anthony Dod Mantle, Schnitt: Daniel P. Hanley, Mike Hill, Musik: Hans Zimmer, Casting: Nina Gold, mit Chris Hemsworth (James Hunt), Daniel Brühl (Niki Lauda), Olivia Wilde (Suzy Miller), Alexandra Maria Lara (Marlene Lauda), Pierfrancesco Favino (Clay Regazzoni), David Calder (Louis Stanley), Natalie Dormer (Nurse Gemma), Stephen Mangan (Alastair Caldwell), Christian McKay (Lord Hesketh), Alistair Petrie (Stirling Moss), Julian Rhind-Tutt (Anthony »Bubbles« Horsley), Colin Stinton (Teddy Mayer), Jamie de Courcey (Harvey »Doc« Postlethwaite), Augusto Dallara (Enzo Ferrari), Joséphine de La Baume (Agnes Bonnet), Geoffrey Streatfield (Peter Hunt), Cris Penfold (Jochen Mass), Kristofer Dayne (Mario Andretti), Antti Hakala (Hans-Joachim Stuck), Andy Joy (Darren Stone), Niki Lauda (Himself), 123 Min., Kinostart: 3. Oktober 2013
Let me tell you a story. After one of the screenings of this film, Paul Newman came up to me and said, »I know what this picture's about. It's about getting to see the tits of the girl whose tits you don't care about seeing, and not getting to see the tits of the girl you want to see.« And I said, »You're absolutely right.«Robert Altman zu The Player
(Film Comment 3/1992)
Der mittlerweile seit 30 Jahren als Kinoregisseur tätige Ron Howard wird gern als »guter Handwerker« bezeichnet. Wenn man als Schuster oder Tischler ein guter Handwerker ist, bedeutet das, dass die Schuhe nicht drücken und die Schubladen nicht klemmen. Wer unvergessliches Design und innovative Ideen liefert, wird nicht als Handwerker bezeichnet, sondern als »Visionär« oder dergleichen.
Wenn man etwas öfter ins Kino geht, will man aber nicht nur gutes Handwerk, sondern auch etwas, an was man sich noch Jahre später erinnert. Und das darf dann auch gerne mal etwas klemmen oder drücken statt nur vom reibungslosen Unterhaltungsbetrieb Hollywoods zu zeugen. Bei Ron Howard ist man da nicht unbedingt an der richtigen Adresse. Seine Filme sind zwar fast durchgehend »gut gemacht«, aber auf Dauer ein wenig langweilig.
Und obwohl ich auch wenig Interesse am Rennsport habe, könnte Rush womöglich der gelungenste Film von Ron Howard sein (ungeachtet meiner abfälligen Bemerkungen habe ich über 80% seiner 21 Kinoarbeiten gesehen). Neben den guten darstellerischen Leistungen (als ehemaliger Schauspieler weiß Howard sehr wohl, wie man Stars inszeniert und hat schon einige Karrieren vorangetrieben – man frage nur Daryl Hannah, Tom Hanks oder Russell Crowe) liegt dies aber zu großen Teilen am Drehbuch von Peter Morgan. Morgan ist ein Spezialist für Biopics (The Queen, The Last King of Scotland oder The Other Boleyn Girl), und mich persönlich hat der Film schon früh in seinen Bann geschlagen, denn ganz ähnlich wie bei Frost/Nixon (der ersten Zusammenarbeit von Morgan und Howard) besteht hier das Kunststück darin, eigentlich zwei Biopics zum Preis von einem zu liefern.
Und so setzt der Film an mit einem Voice-Over und Bildern vom für die Geschichte entscheidenden Rennen am Nürburgring 1976. Man muss dabei schon schmunzeln, weil dies wahrscheinlich der einzige Film ist, bei dem man von Daniel Brühl verlangte, seinen deutschen Akzent härter spürbar zu machen, damit er (auch, wenn die Wiener Schmäh etwas fehlt) möglichst nah am Vorbild Niki Lauda ist.
Dann dreht der Film sechs Jahre zurück und präsentiert seinen anderen Star, der auch auf dem Plakat zu sehen ist (vermutlich aber auch, weil Daniel Brühl zwar ein attraktiver Mann ist, für die Rolle aber mit prominenten Schneidezähnen zu einem »Rattengesicht« modelliert wurde). »Hunt. James Hunt.« Der Name klingt nicht nur wie eine Mischung aus 007 und Mission Impossible, gleich zum Einstieg darf Chris »Thor« Hemsworth auch wie James Bond auftreten, eine Krankenschwester vernaschen, und eine etwas ältere Sekretärin, die man nur in einer Einstellung hinter ihrem Schreibtisch sieht, erinnerte sicher nicht nur mich an »Miss Moneypenny«.
Ausgehend von diesem Einstieg, der abgesehen von einer Verletzung nichts mit dem Rennsport zu tun hat, kann man schon viel über den Film und seine beiden unterschiedlichen Hauptfiguren sagen. Hunt ist ein Medienstar und Genussmensch, Frauen, Alkohol und Drogen spielen in seinem Leben eine große Rolle. Schwester Gemma darf in beispielhafter Weise gleich im Untersuchungsraum ihre Brüste zeigen, später sieht man sie noch einige Zeit an der Seite Hunts, er stellt sie aber seinen Freunden nicht mit dem Vornamen, sondern nur als »Nursey« vor. Wie Sean Connery zu seinen besten Zeiten ein arrogantes Arschloch mit einem gewissen Charme.
Niki Lauda hat durchaus auch Interesse am anderen Geschlecht, doch als er drauf und dran ist, sich mit einer Rothaarigen zu verabreden, warnt ihn der Ferrari-Kollege Clay Regazzoni (Pierfrancesco Favino), dass Hunt mit dieser Dame bereits das Vergnügen hatte und durch seine legendäre Stamina die (pun accepted) Messlatte reichlich hoch angelegt hat. An dieser Stelle ist das Drehbuch ziemlich genial, denn es lässt offen, wie dieser Tip unter Kollegen Lauda beeinflusst. Wo er als Rennfahrer keinen direkten Vergleich scheuen würde, mag er im Zwischenmenschlichen vielleicht den Kürzeren ziehen (sorry, aber wenn wir schon von Sex sprechen, dann soll es auch ein paar blumige Formulierungen geben). Aber der Film lässt es dem Zuschauer offen, sich für einen der beiden »Helden« zu entscheiden – oder auch, darauf zu verzichten (auch wenn Lauda natürlich Österreicher ist, ist schon die Entscheidung, England und Deutschland als Ko-Produktions-Länder extrem clever – nicht nur für die Entstehung des Films, sondern auch für sein Einspielergebnis).
Doch zurück zu den Brüsten (wer glaubt, ich würde diesen Aspekt des Films überinterpretieren, den verweise ich an das Interview im Film Comment, dass Robert Altman einst zu The Player gab – echte Klasseregisseure sind sich aller erzählerischen und dramaturgischen Mittel bewusst). Während Hunt im Verlauf des Films einige Partnerinnen durch die Laken jagt (die Rolle von Olivia Wilde als Hunts Gattin Suzy wird vom Drehbuch sehr balanciert eingesetzt), wird die Liebesgeschichte zwischen Niki und seiner Marlene (Alexandra Maria Lara) sehr konservativ umgesetzt. Die Kennenlerngeschichte ist ein klassischer Meet-Cute aus dem Lehrbuch der Romantic Comedy, angereichert durch charakterliche Details des Rennfahrers. Und nach einer längeren Zeit der Vertrautheit zwischen Niki und Marlene (der Film macht es nicht wirklich klar, wie genau die Zeit zwischen den Eckdaten 1970 und 76 vergeht) kommt dann irgendwann die Hochzeit – und reichlich unerwartet folgt dann eine Szene, bei der auch Frau Lara blankziehen darf. Der Unterschied bei der Herangehensweise der beiden Figuren im Umgang mit dem anderen Geschlecht findet natürlich auf der Rennstrecke seine Entsprechung, aber da der Herr Filmkritiker Brüste spannender als Boliden findet, wird der Fokus halt anders gesetzt.
Doch auch bei der Umsetzung der Autorennen liefert der Film Beeindruckendes! Howard gibt sich Mühe, den Rausch der Geschwindigkeit und das Dröhnen der Motoren erfahrbar zu machen (und hinter dem Motorenlärm stört die Musik von Hans Zimmer auch weniger als normal). Und wenn der Film dann reichlich genau die Formel-1-Saison 1976 beschreibt, zeugt es von einer erstaunlichen Intelligenz, bereits beim ersten Rennen eigentlich vor dem Start abzubrechen und über ein Freeze-Frame nur kurz den Ausgang des Rennens »abzuhaken« (man könnte sich vorstellen, für Formel-1-Liebhaber eine Deluxe-Fassung der DVD oder Blu-Ray anzubieten, die Mitschnitte der kompletten Originalrennen liefert – scheitert aber wahrscheinlich wie so oft an der Rechtefrage).
Die großartigsten Momente hat dieser Film nicht auf der Rennstrecke, sondern am Rand davon. Und die beiden Hauptdarsteller (und einige Nebendarsteller wie Christian »Orson Welles« McKay) werden vom Drehbuch regelrecht verwöhnt. Eine Szene, die an dieser Stelle den Text beenden soll, findet am Nürburgring satt.
Fan: »Niki, ein Autogramm. Mit Datum bitte!«
Niki: »Mit Datum? Warum?«
Fan: »Naja, man weiß ja nie, es könnte das letzte sein …«
 Bildmaterial: Studiocanal  |
Der Schaum der Tage
(Michel Gondry)
Originaltitel: L'écume des jours, Frankreich / Belgien 2013, Buch: Michel Gondry, Luc Bossi, Lit. Vorlage: Boris Vian, Kamera: Christophe Beaucarne, Schnitt: Marie-Charlotte Moreau, Musik: Étienne Charry, Production Design: Stéphane Rosenbaum, Art Direction: Pierre Renson, mit Romain Duris (Colin), Audrey Tautou (Chloé), Gad Elmaleh (Chick), Omar Sy (Nicolas), Aïssa Maïga (Alise), Charlotte Lebon (Isis), Sacha Bourdo (La souris), Philippe Torreton (Jean-Sol Partre), David Bolling (Stimme Jean-Sol Partre), Michel Gondry (Docteur Mangemanche), Vincent Rottiers (Le religieux), Laurent Lafitte (Le directeur de société), Natacha Régnier (La marchande de remèdes), Zinedine Soualem (Le directeur de l'usine d'armement), Alain Chabat (Gouffé), Marina Rozenman (La duchesse de Bovouard), Matthieu Paulus (Le Chuiche), Fred Saurel (Le Bedon), Wilfred Benaïche (Le sénéchal), Alex Barrios (Jésus), August »Kid Creole« Darnell (Duke Ellington), Tilly Pedersen (Fille rousse patron hôtel), Paul Gondry (Erster Arzt), Romain Gondry (Employé giflé), Louise Mast (Floristin), 125 Min. (Original-Schnitt) bzw. 94 Min. (»Internationale« Version, wie der Film auch in deutschen Kinos gezeigt wird), Kinostart: 3. Oktober 2013
Nachdem The Green Hornet für Michel Gondry künstlerisch wie kommerziell nur als Misserfolg gewertet werden kann, vertraut er in seinem übrigens erst zweiten »muttersprachlichen« Spielfilm wieder ganz auf seine Stärken: visuellen Einfallsreichtum umgesetzt per Basteltalent zwischen Old und New School. Bei der Verfilmung eines Romans des in Frankreich sehr bekannten und beliebten Boris Vian (in Deutschland auch als »Die Gischt der Tage« publiziert) kann sich Gondry in jeder Hinsicht austoben, wobei er einige der zahlreichen Metaphern einfach wortwörtlich umsetzt und sich mit seinem verspielten Charme zwischen Stop-Tricks und Augsburger Puppenkiste und einer bittersüßen Liebesgeschichte schon durch die Besetzung von Audrey Tautou überdeutlich nah in Richtung eines »Amélie«-Nachfolgers bewegt. Zumindest in der »internationalen« Version des Films, denn weil man außerhalb von Frankreich weniger Boris-Vian-Experten gibt, konzentriert sich die um eine halbe Stunde gekürzte europäische Schnittfassung des Films ganz auf die Liebesgeschichte. In der Romanvorlage gibt es auch viele intellektuelle Gespräche, doch die Ignoranten in Deutschland wissen ja vermutlich nicht einmal, auf welche Person die Figur »Jean-Sol Partre« anspielen könnte. Immerhin kommentiert der Film diese Figur auch selbst »Das kapiert man nicht. Egal, wie oft man es hört.«
Gänzlich unabhängig davon, ob einem die Kurzfassung vielleicht auch selbst besser gefallen könnte als die längere (sind wir nicht alle ein bisschen Bluna?), man hätte das doch gern selbst entschieden, das Vian-Buch ist übrigens erst vor drei oder vier Jahren in einer »Brigitte«-Reihe neu aufgelegt worden, das Zielpublikum ist also kein komplett anderes, und selbst bei der Liebe muss es doch hin und wieder erlaubt sein, auch mal zu denken.
Doch sprechen wir über das, was wir zu Gesicht bekommen. Rein emotional (im Sinne eines »weepies«) könnte L'écume des jours durchaus mit Love Story mithalten. Romain Duris als Colin ist Ryan O'Neal vielleicht noch etwas voraus, was Attraktivität (und definitiv Schauspieltalent!) angeht, und statt eines Krebsleidens hat seine Angebetete Chloé eine »Seerose« in der Lunge. Um deren Wachstum zu verzögern, umgibt der Liebende sie mit unzähligen Blumen, die anstelle dessen verwelken. In Sachen Allegorien auf die Liebe bietet der Film einiges, das Hochzeitswettrennen mit Unterwasserpassage wird schon auf dem Plakat abgefeiert, und im Gegensatz zu so vielen rührseligen »Date-Movies« hat der Film (wie einst Amélie) den großen Vorteil, dass er großartig unterhält. Wer schon jemals eine diebische Freude empfand, in einem Gondry-Film wie ein Kind zum Träumen verführt zu werden, der wird auch hier voll auf seine Kost kommen. Man ist klar überfordert, die vielen Einfälle auch nur aufzuzählen (hier nur einige meiner Lieblinge: Rubik-Notizwürfel, Klingelspinne, Wetter-Splitscreen, Kampf gegen Sonnenstrahlen, wackliger Stuhl, runde Zimmer, Schwarzweiß-Einsatz), nicht wenige leben auch von den großartigen Nebendarstellern wie Gad Elmaleh, Omar Sy oder Natacha Régnier (und Gondry selbst!). Gerade, weil dieser Film so viel bietet, hätte man ihn durchaus auch zweimal ansehen können. Zuerst die Kurzfassung, dann das Buch lesen (Bibliothek!), und die Langfassung gleich nochmal hinterher. Müsste es bereits als Import-DVD geben.
 Bildmaterial © Concorde Filmverleih 2013/Christian Lüdeke  |
Die andere Heimat
Chronik einer Sehnsucht
(Edgar Reitz)
Deutschland / Frankreich 2013, Buch: Edgar Reitz, Gert Heidenreich, Kamera: Gernot Roll, Schnitt: Uwe Klimmeck, Musik: Michael Riessler, Production Design: Anton Gerg, Hucky Hornberger, Kostüme: Esther Amuser, mit Jan Dieter Schneider (Jakob Simon), Antonia Bill (Jettchen), Maximilian Scheidt (Gustav Simon), Marita Breuer (Margarethe Simon), Rüdiger Kriese (Johann), Philine Lembeck (Florinchen), Mélanie Fouché (Lena Zeitz), Eva Zeidler (Großmutter), Reinhard Paulus (Unkel), Barbara Philipp (Frau Niem), Christoph Luser (Franz Olm), Rainer Kühn (Dr. Zwirner), Andreas Külzer (Dorfpfarrer Wiegand), Julia Prochnow (Hebamme Sophie Gent), Martin Haberscheidt (Fürchtegott Niem), Konstantin Buchholz (Junger Freiheer), Martin Schleimer (Walter Zeitz), Klaus Meininger (Lehrer), Jan Peter Nowak, Johannes Große (Morsch-Brüder), Zoé Wolf (Margotchen), Jeroen Perceval, Jürgen Thelen (Auswanderungswerber), Dettmer Fischbeck, Kathy Becker, Annette Grings-Doffing, Astrid Roth (Nachbarn), Werner Herzog (Alexander von Humboldt), 227 Min., Kinostart: 3. Oktober 2013
Drei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Fernsehserie Heimat (1984), der zwei in den 1960ern respektive zur Wendezeit spielende Spin-off-Serien (1992, 2004) folgten, liefert Edgar Reitz jetzt ein Kino-Prequel zu jenem Werk, das sein Vierteljahrhundert Filmschaffens zuvor überschattet wie eine Mondfinsternis. Ähnlich, wie kaum jemand, auf George Lucas angesprochen, augenblicklich an THX 1138 und American Graffiti denken würde.
Heimat spielte in den Jahren 1919-1982, die Figur, die durchgehend im Zentrum steht, und mit deren Beerdigung die Serie endete, war die von Marita Breuer gespielte Maria Simon (geborene Wiegand). In Die andere Heimat ist Marita Breuer wieder dabei, quasi als Urmutter der Simon-Familie, Margarete Simon. Das ist ein bisschen so, als wenn Carrie Fisher in Episode 1 Anakins Großmutter gespielt hätte. Aber genug Star-Wars-Vergleiche.
Die andere Heimat spielt in den Jahren 1842-44, 75 Jahre vor der Fernsehserie, und auch, wenn man einige Spielorte wiedererkennen kann (wie die Simon'sche Schmiede, den Misthaufen daneben oder die Ruine, die angeblichen einen Schatz beherbergen soll), so ist durch die große zeitliche Distanz ein direkter Bezug schwierig. So wie sich die zweite und dritte Fernsehserie mit brisanten deutschen Zeiten, die Reitz selbst miterlebte, so liegt der Erzählzeitraum diesmal mitten in der Wirtschafts- und Agrarkrise 1840-48 und im Vorfeld der Revolution von 1848. Wenn Reitz an einer Stelle prominent eine Flagge mit den damals noch nicht offiziellen »deutschen Farben« zeigt, ist klar, dass es hierbei auch um Gründungsmythen geht, wie man sie oft im US-amerikanischen Western sieht. Wie ein Gegenstück zu Thomas Arslans Gold (startete im August) zeigt die andere Heimat andere Grüppchen, bevor sie die Heimat verlassen und nach Amerika (in diesem Fall aber Brasilien) aufbrechen. Die Migrantensituation mal von der anderen Seite betrachtet.
Da die Heimat-Serien ein kleiner Exportschlager wurden (nicht ganz so erfolgreich wie Derrick und Kommissar Rex, aber Die zweite Heimat wurde beispielsweise im Ausland weitaus aufmerksamer beäugt als in Deutschland), bekam Reitz auch aus fernen Landen Rückmeldungen und ein Motivationsgrund für das Prequel war ein ferner Verwandter in Brasilien, der ebenfalls mit Nachnamen Reitz heißt und Edgar sogar ähneln soll. Es stellte sich bei Nachforschungen sogar heraus, dass selbst heute noch in Brasilien von den Nachfahren der Auswanderer der Hunsrücker Akzent gesprochen wird.
Doch zurück zu Die andere Heimat und den Anknüpfungspunkten zur Ursprungsserie. Während die zweite und dritte Serie den Ort Schabbach größtenteils verließen, und der Figur des »Hermännchen« nach München etc. folgten, liegt bei Die andere Heimat der Fokus wieder ganz auf Schabbach. Und im Gegensatz zu 1984 konnte man diesmal kaum vorhanden Bauten (oder halbe Dörfer) nutzen, sondern musste ein historisch korrektes Schabbach neu aufbauen. Mit dieser beeindruckenden Kulisse gibt Reitz in der ersten Szene, einer längeren Plansequenz (mit Pferd!) auch ziemlich an, doch auf lange Sicht wirkt das neue Schabbach dann doch eine Spur kleiner, als etwa die Statistiken zur Kindersterblichkeit bei Diphterie implizieren würden. Aus teilweise nachvollziehbaren Gründen sieht man auch vorher nur wenige Kinder durchs Bild laufen, einzig das durch einen Klumpfuss benachteiligte Margotchen wirkt wie ein Äquivalent zum einäugigen Sohn des Glasers in Heimat.
Die erwähnte Plansequenz endet bereits damit, dass die Hauptfigur des Films, Jakob (Jan Dieter Schneider), wie Hermännchen ein (beinahe) intellektueller Träumer, vom Vater gemeinsam mit einem Buch aus dem Haus gejagt wird. Jakob saugt sein Fernweh aus seinen Lektüren. Der Film kann nicht überzeugend erklären, woher das nicht eben wohlhabende Provinzkind immer wieder Bücher herbekommt, die sich bevorzugt mit Brasilien beschäftigen und etwa weitreichende Einblicke in die Sprachen indigener Völker liefern (Jakob kann übrigens auch englische, spanische und portugiesische Passagen ohne Probleme verstehen und übersetzen – und damals gab es weder Amazon noch Fernkurse). Aber gehen wir einfach davon aus, dass Reitz auch dies hätte erklären können – doch dann hätte der Film die Vier-Stunden-Grenze überschritten.
Ähnlich wie in der Folge Hermännchen findet sich auch Jakob sehr schnell zwischen zwei Frauen (hier aber gleichaltrig) wieder, die den zurückhaltenden Jüngling recht aggressiv mit der Sexualität konfrontieren. Und sie es in diesem Fall auch nur, weil sie unter seinen Augen als »Heilmethode« nackt eine Alm herunterrollen. Ähnlich wie beim Schützenfest in Hermännchen gibt es auch hier ein Volksfest (was nebenbei auch wichtig für die Revolutionsstimmung ist), bei dem Jakob Jettchen (Antonia Bill) gerne besser kennenlernen würde. Doch stattdessen nutzt Reitz das »Novemberfest« (auch symptomatisch für die folgenden harten Zeiten), um wie in einem typischen Bollywood-Film die Stimmung kurz vor der Pause reichlich zu dämpfen. Zu diesem Zeitpunkt steht bereits fest, dass Jakob in den zweiten zwei Stunden noch einiges vollbringen muss, wenn er einen (oder gar zwei) seiner großen Wunschträume erfüllen will (Jettchen respektive Brasilien, Kulmination wäre »mit Jettchen nach Brasilien«). Wer die Originalserie kennt (ich kenne sie fast zu gut, weil ich zum Studiumsende eine Hauptseminarsarbeit über den Farbeinsatz schrieb), wird einige Themen wiedererkennen. Zufallsbegegnungen, ungewollte Schwangerschaften und natürlich die legendäre Mär, dass Schabbach genau auf halbem Weg zwischen Berlin und Paris liegt, was dem Film einen possierlichen Gastauftritt von Werner Herzog als einer historischen Figur verschafft (wer zu neugierig ist, schaut in die Stabangaben). Auch die farbigen Einsprengsel in das Schwarzweißmaterial nutzt Reitz hier wieder (sogar mit einem glühenden Hufeisen als Intro – ganz wie in der Fernsehserie), doch da die technologischen Möglichkeiten vorangeschritten sind, geht es hier nicht um einmontierte Einstellungen, sondern jeweils nur kleine Bildelemente, wobei gerade die Farbenvielfalt der Natur und die vielen Worte der brasilianischen Ureinwohner für »grün« Reitz beflügeln und dem Kinofilm einen ästhetischen Reiz verschaffen, den die Fernsehserie nur selten in dieser Form bieten konnte. Vielleicht haben sich auch meine Sehkonventionen seit den 1980ern verändert, aber für das Angebot an »Handlung« ist das Erzähltempo in Die andere Heimat reichlich gemächlich. Wenn sich der Soundtrack mal wieder in Sphärenklängen suhlt oder Jakob lange Passagen aus seinem Notizbuch als Voice-Over vorträgt, fragt man sich schon, ob der Film nicht zwanzig Minuten oder eine halbe Stunde kürzer hätte ausfallen können. Aber vermutlich verlangt ein Heimat-Film einfach nach einer Mammut-Filmlänge. Immerhin musste ich zu keinem Zeitpunkt mit dem Schlaf ringen, und das passiert Filmkritikern öfter als sie es lieb sind.
Und im Gegensatz zu Episode 1 ist es hier überhaupt kein Problem, dass die »Spezialeffekte« weitaus versierter sind als im Original.
Das mit Abstand Genialste an diesem vermutlich letzten Ausflug ins »Schabbach-Universum« ist aber der Starttermin!
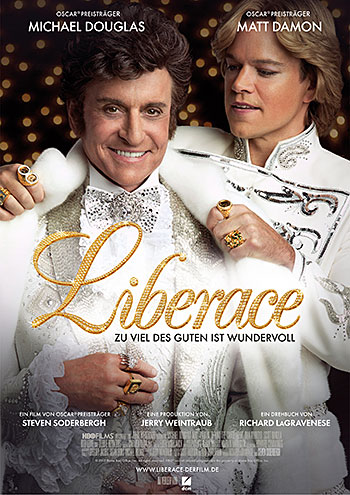 Bildmaterial © dcm 2013 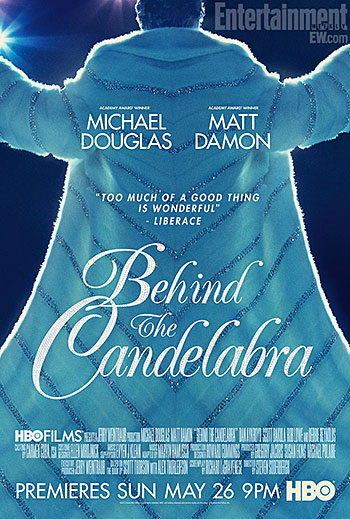 |
Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll
(Steven Soderbergh)
Originaltitel: Behind the Candelabra, USA 2013, Buch: Richard LaGravenese, Vorlage: Scott Thorson, Alex Thorleifson, Kamera: Peter Andrews (d.i. Steven Soderbergh), Schnitt: Mary Ann Bernard (d.i. Steven Soderbergh), Musik: Marvin Hamlisch, Szenenbild: Howard Cummings, Kostüme: Ellen Mirojnick, mit Michael Douglas (»Lee« Liberace), Matt Damon (Scott Thorson), Dan Aykroyd (Seymour Heller), Rob Lowe (Dr. Jack Startz), Scott Bakula (Bob Black), Debbie Reynolds (Francis Liberace), Cheyenne Jackson (Billy Leatherwood), Jane Morris (Rose Carracappa), Garrett M. Brown (Joe Carracappa), Boyd Holbrook (Cary James), Ray Arnett (Tom Papa), Nicky Katt (Mr. Y), David Koechner (Notar bei der Adoption), Kiff Vanden Heuvel (Scotts Halbbruder Wayne), Paul Reiser (Scotts Anwalt), 118 Min., Kinostart: 3. Oktober 2013
Kaum mehr als ein halbes Jahr ist es her, als Steven Soderbergh im Vorfeld von Side Effects bekannt gab, sich bis auf weiteres aus dem Kinogeschäft zurückzuziehen, und schon startet sein neuer Film. Wer konnte denn damit rechnen, dass sich der Fernsehsender HBO bereiterklärte, ein langjährig gehegtes Projekt Soderberghs großzügig zu finanzieren. Laut Presseheft soll Soderbergh schon während der Dreharbeiten zu Traffic Michael Douglas spontan gefragt haben, was dieser davon hielte, Liberace zu sprechen, woraufhin Douglas eine kleine Improvisation gab, die »alle platt gemacht hat«.
Das Drehbuch (nach einer Autobiographie des hier von Matt Damon gespielten Scott Thorson) schrieb Richard LaGravenese, mittlerweile als Kinoregisseur etabliert (Living Out Loud, Freedom Writers, P.S. I love you), einst durch die Drehbücher zu The Fisher King oder Bridges of Madison County positiv aufgefallen.
Worin er hier eine regelrechte Meisterschaft entwickelt hat, sind die eindeutigen Zweideutigkeiten im Skript. Das beginnt schon mit dem Filmtitel, im Original Behind the Candelabra. Feingeister wie Beavis & Butthead würden hier sagen: »heh heh, he said 'behind'!« Beim Originalplakatmotiv des Films wird dann auch noch die Hauptfigur von hinten gezeigt. Da kann mir keiner sagen, dass ich mir das nur einbilde.
Mitunter mag es ja sogar der Wirklichkeit verpflichtet sein, dass Liberace einst mit einem jungen Mann namens »Billy Leatherwood« (!) unterwegs war, während keiner seiner heterosexuellen Fans einen Schimmer über die Orientierung des Showmans hatte. Doch die Art und Weise, wie der Film seine Anzüglichkeiten genüsslich zelebriert, ist durchaus zwiespältig, denn Schwulsein wird hier präsentiert wie in der Bullyparade, und es ist durchaus möglich, dass Teile des Publikums durch den Film ein völlig falsches Bild vermittelt bekommen. Es geht um Prunk, Oberflächlichkeiten, Geschäftssinn und Schönheitsoperationen. Natürlich gibt es Menschen, die ihr Leben so gestalten (ich würde ja gern eine Kritik zu dem Film lesen, die Harald Glööckler geschrieben hat), aber abgesehen vom Geschäftssinn und der Musikalität offenbart der Film so gar keine positiven Charaktereigenschaften seiner Figuren. Der eine (Michael Douglas als Liberace) kauft sich alles, was er möchte und entsorgt es auch irgendwann wieder, der andere (Matt Damon als Scott Thorson) verkauft sich, beide führen ein Leben voller Lügen und psychischer Abgründe. Und der Film stellt das größtenteils als eine äußerst amüsante Geschichte dar.
Manches ist dabei so überzogen, dass man nicht umhin kommt zu lachen (etwa beim »Hausboy« Carlucci oder dem in seinem Minenspiel oscarverdächtigen Rob Lowe als Schönheitschirurg), und es geht sogar so weit, dass Komiker wie Dan Aykroyd und David Koechner mitspielen – in durchaus ernsten Rollen, aber dennoch das Zwerchfell kitzelnd. Die Geschichte ist eigentlich so tragisch wie Boogie Nights, aber Soderbergh macht daraus einen Adam-Sandler-Film, bei dem der Drahtseilakt zwischen »tongue-in-cheek« und homophoben Klischees vor allem durch das reale Vorbild verharmlost wird. Nach einigen Eingriffen, die aus dem jungen Lover Scott eine Art jungen Bruder Liberaces machen sollen (er wird dann auch beim Verkauf von Merchandiseartikeln für Liberaces Sohn gehalten), fasst Scott das Ergebnis zusammen: »I look like my father! I look like my father in drag! I look like my father in Hush Hush, Sweet Charlotte!« So wie hier wird die Tragik der Geschichte häufig unter der unterhaltsamen Farce verborgen. Natürlich ist es auch ein ganz großes Spektakel, Michael Douglas in dieser Rolle zu sehen (und Matt Damon leistet auch beeindruckendes), doch Liberace wird im Film wie folgt zitiert: »I just don't wanna be remembered as some old queen.« Deshalb schreibt es u.a. auch eine (größtenteils fiktive) Autobiographie, in der er von seiner großen Liebe, einer Eiskunstläuferin, schwärmt. Der Film führt aber exakt diese »old queen« vor: Nahezu kahl unter verschwenderischen Toupets, Privatjets charternd, um Medizin für seine Schoßhunde zu bekommen, junge Männer mit einer einstudierten Routine verführen und später wie gebrauchte Kondome abwerfen. Ob all dies vielleicht schon am Buch Thorsons liegt, kann ich nicht beurteilen, aber wenn Thorson schließlich in einem Postamt arbeitet, ist auch er für den Film nur eine Witzfigur – die Tragik ist immer nur Nebensache, ebenso wie die durchaus großen Gefühle. Und das ist schade.
Rezensionen zu Alphabet (Erwin Wagenhofer), Jackpot
(Magnus Martens), Das kleine Gespenst (Alain Gsponer), Runner Runner (Brad Furman) und Scherbenpark (Bettina Blümner).
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 10/3:
10/3: