
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
2. August 2015 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||
|
|
|
 |
Taxi
(Kerstin Ahlrichs)
Deutschland 2015, Dt. Verleihtitel: Taxi – nach dem Roman von Karen Duve, Drehbuch: Karen Duve, Lit. Vorlage: Karen Duve, Kamera: Sonja Rom, Schnitt: Florentine Bruck, Musik: Florian Tessloff, Songs: Michel van Dyke, Szenenbild: Jochen Dehn, mit Rosalie Thomass (Alexandra »Alex« Herwig), Peter Dinklage (Marc Williams), Stipe Erceg (Dietrich), Robert Stadlober (Rüdiger), Antoine Monot, jr. (Taximörder), Tobias Schenke (Udo »Dreidoppelsieben«), Özgür Karadeniz (Mergolan), Armin Rohde (Betrunkener Fahrgast), Leslie Malton (Alex' Mutter), Jannik Schürmann (Alex' Bruder), Eisi Gulp (Alkoholiker), Christopher Weiß (Marcs Freund), Carolyn Genzkow (Prostituierte), Sascha Reimann (Zuhälter), Henning Peker (Dompteur), 94 Min., Kinostart: 20. August 2015
Seit einigen Jahren habe ich zunehmend weniger Lust, mir Filme in deutscher Synchronisation anzutun. Englischsprachige Comics oder Bücher lese ich auch ungern in Übersetzung (hier sind Ausnahmen fast immer eine Geldfrage), aber bei Filmen, die ich mir ja größtenteils auf Pressevorführungen anschaue, verzichte ich dann lieber bei Synchros und kann dann beispielsweise ganz prima damit leben, wenn ich mehrere Jahre auf Iron Man 3 (da habe ich damals sogar das Kino nach wenigen Sekunden wieder verlassen) oder den jeweils aktuellen Judd-Apatow-Film warten muss. Die direkte Folge dieses freiwilligen Verzichts ist, dass ausländische Filme bestimmter unbelehrbarer Verleihe, und auch ein Großteil der (als »Kinderware« abgestempelten) Animationsfilme (die ich eigentlich sehr mag) auf satt.org nicht mehr besprochen werden. In den letzten Jahren habe ich die Anzahl der Synchros, die ich im Jahr ertrage, immer weiter runtergeschraubt, und inzwischen gehe ich eigentlich nur noch zu solchen Filmen, wenn ich einen ganz konkreten Bezahljob dafür habe. Auch ich bin käuflich, und wenn man als Nutte unterwegs ist, kann man nicht immer damit rechnen, dass der Job auch noch Spaß macht.
2015 ist in dieser Hinsicht ein irgendwie seltsames Jahr, denn ich bin jetzt schon zum dritten Mal zu einem »deutschen« Film mit deutschen Schauspielern hingegangen, und habe dabei dennoch eine Synchro zu Gesicht bekommen. Bei Gespensterjäger (Bezahljob) war es so, dass man das Ganze wie eine internationale Produktion aufgezogen hat, der kleine Hauptdarsteller eh englisch sprach und die ganzen deutschen Stars (Anke Engelke, Karoline Herfurth, Christian Tramitz und so) ihren Text hübsch auf Englisch aufgesagt haben – nur um dann bei tatsächlichen Kinoeinsätzen im Ausland doch synchronisiert zu werden, weil beim einen oder anderen Darsteller der deutsche Akzent dann doch zu ausgeprägt ausfiel. Die »Originalfassung« des Films hat also außer ein paar an der Produktion beteiligten Menschen niemand zu sehen bekommen. Immerhin habe die deutschen Stars sich dann alle selbst synchronisiert und haben dadurch vermutlich einmal mehr Honorar einstreichen können. Bei Das Zimmermädchen Lynn hat man sich für eine komplette Nachvertonung entschieden (das passiert übrigens mitunter auch in anderen Ländern, mit ein wenig Sensibilität spürt man es aber fast immer), weil das erklärte Ziel des Regisseurs es war, dass der Film keinen »realistischen« Eindruck auf das Publikum haben sollte. Das hat dann auch irgendwie geklappt, aber im Kinosessel hat es mir dennoch wehgetan.

Bildmaterial © by Georges Pauly und B&T Film GmbH
Und Taxi (so steht der Titel im Vor- wie Abspann, und ich gebe mich nicht mit dem komplizierten deutschen Verleihtitel ab) hat eine andere Begründung für eine Synchro. In Karen Duves Roman geht es unter anderem um eine Beziehung der weiblichen Hauptfigur mit einem Kleinwüchsigen ehemaligen Schulkameraden namens Marco. Als man dafür den amerikanischen Game of Thrones-Star Peter Dinklage (Living in Oblivion, The Station Agent, X-Men: Days of Future Past) verpflichten konnten, bekam dieser zwar (laut Abspann) einen »Sprach-Coach«, ist aber nun im kompletten Film synchronisiert zu hören (somit gibt es auch bei diesem Film keine »Originalfassung«). Die Dame von der Presseagentur hat mich bei einem Gespräch nach dem Film noch darauf hingewiesen, dass ich meine Kritik nicht auf diesen Aspekt beschränken solle – und das mache ich natürlich auch nicht. Nur noch wenige Absätze, und ich widme mich auch anderen Aspekten des Films :-)
Nun stammt nicht nur die Romanvorlage, sondern auch das Drehbuch zum Film von Karen Duve, die offenbar sehr involviert war in der Produktion und unter anderem dafür sorgte, dass man exakt in der selben Wohnung drehte, in der sie seinerzeit die autobiographische Grundlage des Romans durchlebte. Und sie soll sogar ihre (offenbar gut konservierte) Garderobe aus den 1980ern der Hauptdarstellerin Rosalie Thomass zur Verfügung gestellt haben (ich gehe jetzt mal davon aus, dass man daraus dann jeweils mehrere Duplikate in der richtigen Größe hat herstellen lassen). Nun sind Karen Duve und Regisseurin Kerstin Ahlrichs immerhin cleverer als Til Schweiger und haben begriffen, dass man dem Zuschauer nicht unterjubeln sollte, dass zwei Personen die selbe Schulklasse besucht haben, wenn zwischen ihnen ein Altersunterschied von 17, 18 Jahren liegt. Deshalb ist die Figur des Kleinwüchsigen im Film nur eine vage Bekanntschaft, die mal längere Zeit den selben Club (namens »Kir«) frequentiert hat wie unsere Taxifahrerin. Aus irgendwelchen Gründen heißt die Filmfigur jetzt auch nicht mehr Marco (Nachname wird nicht erwähnt), sondern Marc (den Nachnamen kann man mal auf einem Ausweis erhaschen: Russell). Das klingt irgendwie schon etwas anglophon, aber in der Synchrostimme habe ich keinen englischen oder amerikanischen Akzent erkannt. Nein, Marc Russell soll tatsächlich sehr deutsch sein, er hat sogar in seinem Bücherregal das »Advanced Learner's Dictionary of Current English« stehen, was man sich als Muttersprachler höchstens kaufen würde, wenn man irgendeine Lehrtätigkeit ausübt. Die Frage, die sich mir immer wieder stellte, weder Peter Dinklage den Mund öffnete und eine seltsame Stimme zu hören war: Warum hat man aus der Figur nicht einfach einen Amerikaner oder Engländer gemacht, der in Hamburg lebt? Die Antwort darauf ist leider zu offensichtlich: Weil irgendein potentieller deutscher Zuschauer sich dadurch hätte abschrecken lassen können, weil er entweder kein Englisch versteht oder keine Lust hat Untertitel zu lesen. Hätte der Film tatsächlich aus den 1980ern gestammt, in denen er spielt, hätte ich das auch durchgehen lassen, aber seitdem hat sich die Welt ja weitergedreht. Hauptdarstellerin Rosalie Thomass hat selbst in Beste Chance, einem Film, der schon sehr auf ein lokales (sprich bayrisches) Publikum zugeschnitten war, wie ihre Filmeltern größere Teile der Handlung in Indien verbracht, und selbst in einem Film, der sich so über Lokalkolorit und Heimatverbundenheit definiert, ist es ganz selbstverständlich, dass man sich auch mal auf Englisch unterhält. Aber im Falle Taxi / Peter Dinklage macht man sich zum Sklaven eines möglichst weit unten angesetzten Zuschauerniveaus – und über Leute, die sich durch die in Trailern vernommene Synchrostimme von Peter Dinklage abgeschreckt fühlen könnten (zugegeben, das sind weniger), zerbricht man sich keinesfalls den Kopf. So, aber genug davon, jetzt kommen die anderen Aspekte.
Ich bin kein Kenner des Werkes von Karen Duve, habe mir aber für diese Kritik mal Taxi durchgelesen. Hier folgt eine kleine Aufzählung der Veränderungen. Der Roman hat zwei Teile, einer spielt 1984-86, der zweite 1989/90. Davon merkt man im Film nichts mehr. Man könnte zwar darüber nachdenken, welcher Zeitraum im Film geschildert wird, aber es würde mich wundern, wenn irgendein unbedarfter Zuschauer ohne Roman-Kenntnis auf die Idee kommen würde, dass mehr als vielleicht ein halbes bis dreiviertel Jahr vergeht. Vielleicht habe ich aber auch nicht ausreichend darauf geachtet, wie oft es schneit.
Im Roman unterscheiden sich die beiden Teile u.a. dadurch, dass etwas über zehn Seiten nach Beginn des zweiten Teils die Figur des Mergolan, dem der Taxibetrieb gehört, komplett verschwindet, weil Udo Dreidoppelsieben die Firma übernommen hat, mit der Unterstützung seines Bekannten Nusske. Von den zwei Udos im Roman wird Zwonullfünf eliminiert (für mich persönlich hat der auch nie wirkliche Gestalt angenommen), Mergolan bleibt durchgehend Chef, bekommt aber gegen Ende die Probleme von Udo und Nusske zugeschoben und bekommt dann auch die Übernachtungsszene, die Nusske hatte. Das ist durchaus clever, weil man sich die Vorstellung einer neuen Figur spart und stattdessen den aufgebauschten Mergolan (gespielt von Özgür Karadeniz), eine der besten Filmfiguren, ausarbeiten konnte. Das ist bereits die deutlichste Veränderung.
Ansonsten merkt man dem Drehbuch leider an, dass es von der Romanutorin stammt, die unbedingt einige Sätze und Situationen »retten« wollte, und dafür mit einem Voice-Over der Erzählerstimme Alex' arbeitet. Und so wird aus einem durchaus dialoglastigen Roman halt ein Film, in dem auch viel gequatscht wird. Das Casting von Stipe Erceg, Robert Stadlober, Antoine Monot jr, und Tobias Schenke als den vier Taxifahrerkollegen, mit denen Alex sich unterhält und rumärgern muss, finde ich eher fragwürdig, weil die im Film öfters wie Witzfiguren wirken. Allen voran Robert Stadlober, der aktuell etwas auf den Hund gekommen zu sein scheint (siehe Der Bau), und zwar so tumb wie sein Romanvorbild daherkommt, aber nicht so gehässig / fast gefährlich in seinem wahnhaften Frauenhass.
Die Fahrgäste sind eigentlich das Beste am Film, insbesondere dann, wenn sie eher skizzenhaft bleiben wie das verheulte Mädel mit dem älteren Mann, bei dem man sich nicht ganz sicher ist, ob es sich um ihren Vater oder ihren Zuhälter handelt. Im Roman ist es eher so, dass schon die erste Info über Fahrgäste klarmacht, dass es sich um einen Alkoholiker oder was auch immer handelt. Im Film kann man das dann eher selbst herausbekommen.
Rosalie Thomass bekommt den Hamburger Dialekt ziemlich gut hin, die Chemie zwischen ihr und Dinklage funktioniert trotz »ich-wollte-nicht-mehr-darüber-reden« recht gut, und der Look der 80er wurde auch super eingefangen, die Musik ist bis auf ein paar Aussetzer auch überdurchschnittlich für einen deutschen Film.
Aber nun komme ich zu dem Punkt, warum ich unbedingt den Roman lesen wollte, denn es gibt zumindest einen sehr visuellen Punkt im Drehbuch, für den ich Karen Duve loben wollte (auch, wenn die Interpretation bestimmter Details natürlich auch von der Regisseurin oder dem Ausstatter stammen könnte.
In der Original-Duve-Wohnung (60 m² Loft), die Alex bewohnt, wird von ihr der Fußboden himmelblau gestrichen (im Roman »taubenblau«). Ihr Kollege/Freund Dietrich (Stipe Erceg) kommt während der Malerarbeiten in die Tür gestürmt, antwortet auf den Hinweis »Nicht reinkommen, ist frisch gestrichen!« mit einem typisch herablassenden »Ach was, ist schon trocken!« und kurz darauf stellt sich auch noch heraus, dass er wohl in einen Hundehaufen getreten sein muss. Das Detail mit der Hundekacke, die in eine Fußmatte abgestreift wird, gibt es auch im Roman, nur in einer anderen Wohnung. Im Film ist diese Szene aber sehr exemplarisch, Dietrich und dann auch noch Rüdiger drängen sich in Alex' Leben und zwingen ihr die eigene Lebensanschauung (und Lektüre) auf. Und das Himmelblau wirkt wie ein Zukunftsentwurf, der nicht nur durch reingetretene Hundescheiße (und später Orangensaft) sofort seiner unschuldigen optimistischen Reinheit beraubt wird. Auch die etwas klamaukhafte Einstellung, in der man sieht, dass Alex sich in der Mitte des Raums sozusagen »eingepinselt« hat (statt in den Ecken zu Beginnen und sich zur Tür hinzuarbeiten), passt auf der interpretatorischen Ebene ganz großartig zu den Fehlstarts und Sackgassen in ihrem Leben. Gemeinsam mit einigen Montagen, die Hamburger Straßenszenen mit Großaufnahmen aus der Fahrerkabine verbinden, ist das ein wirklich »filmischer« Moment in Taxi, der nicht nur »adaptiert« wurde, sondern dazuerfunden. Wenn es davon nur mehr gegeben hätte …
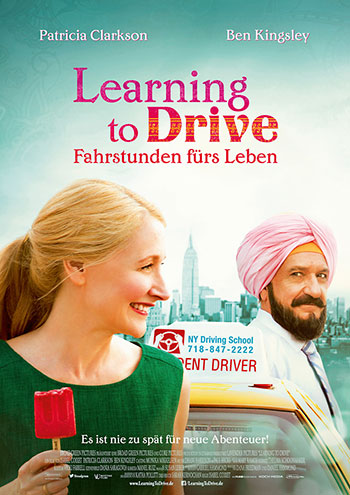 |
Learning to Drive
Fahrstunden fürs Leben
(Isabel Coixet)
USA / UK 2014, Originaltitel: Learning to Drive, Buch: Sarah Kernochan, Kamera: Manel Ruiz, Schnitt: Keith Reamer, Thelma Schoonmaker, Musik: Dhani Harrison, Production Design: Dania Saragovia, Set Decoration: Robert Covelman, mit Patricia Clarkson (Wendy), Ben Kingsley (Darwan), Sarita Choudhury (Jasleen), Jake Weber (Ted), Grace Gummer (Tasha), Daniela Lavender (Mata), Avi Nash (Preet), Samantha Bee (Debbie), Matt Salinger (Peter), Michael Mantell (Wendy's Father), Amelia Fowler (Dollar Store Clerk), Beau Baxter (Debbie's Husband), Nora Hummel (Driving Examiner), 90 Min., Kinostart: 6. August 2015
Die fast ausschließlich durch englischsprachige Produktionen bekannte Katalanin Isabel Coixet war einst ein (kleiner) Hoffnungsträger mit eigensinnigen Arthaus-Autorenfilmen wie My Life without me oder The Secret Life of Words. In letzter Zeit scheint sie aber komplett auf den Hund gekommen, zumindest zwei ihrer letzten drei Regiearbeiten, die Young-Adult-Gruselnummer Another Me und der diesjährige Berlinale-Eröffnungsfilm Nobody wants the Night waren jedenfalls schlimme Rohrkrepierer. Verglichen damit ist der dazwischen entstandene Learning to Drive eigentlich noch erträglich, aber leider auch nur eine halbwegs kompetente Routinearbeit, die die frühere persönliche Note der Regisseurin schwer vermissen lässt.
Zwar ist in diesem Film vieles wie in den Arbeiten zu Beginn ihrer Regiekarriere, aber von der Sturm-und-Drang-Phase ist nichts mehr zu erkennen. Stattdessen wirkt vieles gutgemeint, aber letztlich lapidar. Was nicht zuletzt daran wirkt, dass der Film sehr an Cairo Time erinnert, einen viel gewagteren, persönlicheren Film, in dem es ebenfalls darum ging, dass eine nicht mehr ganz junge Frau mit … sagen wir mal: Beziehungsproblemen … sich in ein einfühlsamen exotischen Mann zu verlieben droht, was zu einigen Erkenntnissen und Lehrstunden führt. Und in der Hauptrolle fand man auch damals (keine fünf Jahre her) die meist in Nebenrollen verschlissene Patricia Clarkson, aus deren Sicht vermutlich beide Projekte sehr vielversprechend klangen (immerhin drehte sie ja mit Kingsley und Coixet zusammen auch mal die Philip-Roth-Verfilmung Elegy – vermutlich arbeitet es sich angenehm mit den Kollegen). Doch seinerzeit lebte der Film nicht nur von der exotischen Note seines Drehorts (vgl. auch Map of the Sounds of Tokyo) statt nur selten gezeigte Bezirke von New York vorzuführen – auch war Alexander Siddig ungeachtet der darstellerischen Leistung von Ben Kingsley einfach die authentischere Wahl für einen faszinierenden Inder.
Der eine Pluspunkte des neuen Films liegt darin, dass es diesmal nicht nur um Frau Clarkson geht, sondern man tiefere Einblicke in die Figur des von Kingsley gespielten Sikh Darwan Singh Tur bekommt, der zwar als »Fahrlehrer« und Taxifahrer eine deutliche Beraterrolle im Leben der durch die plötzliche Trennung komplett aufgeriebene Literaturkritikerin Wendy (Clarkson) zugeschrieben bekommt, dabei aber fast noch die größeren persönlichen Probleme hat. Vor allem durch seine spät arrangierte Ehe zur kaum ein paar Brocken englisch sprechenden Jasleen (Sarita Choudhury), die beim leichten Knistern zwischen den beiden Hauptfiguren zunächst wie die eigentliche leidtragende wirkt – ehe sie in einer zu rasanten Drehbuchvolte Freundinnen mit ähnlichem Migrationshintergrund findet – und damit auch das Selbstbewusstsein, sich ihrem gönnerhaft bestimmenden Gatten entgegenzustellen.
Die interessantesten Momente des Films drehen sich zumeist um die Nebenfiguren: Wendys Noch-Ehemann Ted (Jake Weber), der sie ausgerechnet mit einer Buchautorin hintergeht; Darwans von der Einwanderungsbehörde gejagter »Neffe« (»This is America and I can do what I want – as long as they don't ask for my papers.«) oder Wendys Tochter Tasha, deren Darstellerin Grace Gummer übrigens eine Tochter von Meryl Streep ist (und das sieht man auch deutlich).
Viele Aspekte des Films wirken indes zu klischeehaft oder allzu konventionellen Drehbüchern entsprechend: der sehr auf indische Klänge (à la Cornershop) eingeimpfte Soundtrack, die Streiterei über korrekt gewürzte indische Speisen, der tägliche uninformierte Fremdenhass gegenüber Turbanträgern, die Komplikationen bei Wendys Fahrunterricht. Und nicht zuletzt die auf quasi-philosophische Bedeutung aufgeblasenen Fahrratschläge. Zwischen solchen Ärgernissen beachtet man die zwei, drei gelungeneren Ideen des Films leider kaum.
Natürlich wird auch Isabel Coixet älter und angepasster, und man will ihr dafür keinen Vorwurf machen – aber dieses gediegene Gutmenschen-Kino hat mit ihren früheren, teilweise fast radikalen Ideen fast nichts mehr zu tun, sondern geht stark in Richtung Tantenkino. Angewürzt mit ein paar Sexwitzen, über die auch 60jährige halbschockiert kichern können.
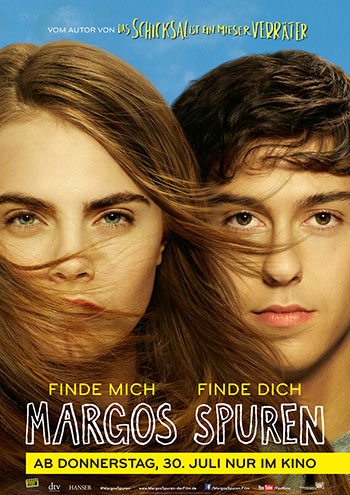 |
Margos Spuren
(Jake Schreier)
Originaltitel: Paper Towns, Buch: Scott Neustadter, Michael H. Weber, Lit. Vorlage: John Green, Kamera: David Lanzenberg, Schnitt: Jacob Craycroft, Musik: Ryan Lott, mit Nat Wolff (Quentin Jacobsen), Cara Delevingne (Margo Roth Spiegelman), Austin Abrams (Ben Starling), Halston Sage (Lacey Pemberton), Justice Smith (Radar), Jaz Sinclair (Angela), Cara Buono (Connie Jacobsen), Meg Crosbie (Ruthie), Caitlin Carver (Becca Arrington), Griffin Freeman (Jase), RJ Shearer (Chuck Parsons), Josiah Cerio (Young Quentin), Hannah Alligood (Young Margo), Susan Macke Miller (Mrs. Spiegelman), Tom Hillman (Mr. Spiegelman), Ryan Boz (Young Quentin 14), Madeleine Murden (Young Margo 14), Ansel Elgort (Mason), Jay Duplass (Teacher), 109 Min., Kinostart: 30. Juli 2015
The Fault in our Stars hat mir ja immerhin so gut gefallen, dass ich ihn mir (wegen der Farbdramaturgie) zweimal im Kino angeschaut habe und sogar die Romanvorlage von John Green gelesen habe. Bei der zweiten Green-Verfilmung Paper Towns gibt es abermals einen interessanten Regisseur am Beginn seiner Karriere (Jake Schreier von Robot Frank), das Drehbuch ist vom selben Autorenpaar (Neustadter / Weber, die durch (500) Days of Summer bekannt wurden), Nat Wolff aus The Fault und Writers. hat jetzt den Schritt zum Hauptdarsteller geschafft und Model Cara Delevingne war ja im unsäglichen Face of an Angel – trotz keiner wahrnehmbaren Schauspieltalente – noch das erträglichste gewesen. Die Vorzeichen standen also gut.
Aus der Sicht des Zielpublikums, also der jungen John-Green-Leserinnen und (seltener) -Leser, hat man auch alles ziemlich perfekt hinbekommen. Ich konnte mir quasi die spitzen Schreie im Publikum vorstellen, als Ansel Elgort als reiner Crowd-Pleaser einen kleinen Kurzauftritt bekam, und wenn man den ganzen Liebeskram zum ersten bis dritten Mal erlebt, hat der Film durchaus einige Einsichten zu bieten, die einem noch neu sein könnten.
Für mich persönlich baute sich aber recht früh ein gewisser Widerwillen gegen den Film auf, der sich fast zum Hass aufstaute. Gerade weil die Manipulation des Publikums so perfekt abgestimmt war.
»From the moment I saw [...] I was hopelessly madly in love.« Natürlich versucht man, von der Romanvorlage möglichst viel zu übernehmen, aber ob die Voice-Over-Stimme dabei immer die beste Wahl ist, bleibt anzuzweifeln. Solches »Buch-Kino« (siehe auch Taxi weiter oben) verzichtet eben auf die Möglichkeiten des Mediums Film, wenn man sich so sklavisch an der Vorlage abarbeitet. Um das auszugleichen, sieht man Margo gerade zu Beginn des Films so häufig in Zeitlupe, das es schon nervt. Sicher, es geht in nicht geringem Maße, darum, dass Erzähler Quentin seine erste große (erst mal unerwiderte) Liebe auf ein Podest hievt und idealisiert, nur um dann später irgendwann die zentrale Einsicht zu bekommen: »She was a girl. It took me a long time to realize.« (Wer das jetzt als Spoiler erachtet, tut mir leid.) Aber Zeitlupe ist so ein filmisches Mittel, was man gezielt einsetzen sollte. Sicher, wenn ich jetzt an die Virgin Suicides denke, so gab es auch dort einen Zeitlupen-Overkill, an dem ich mich nicht gestört habe … aber da ging es auch von Anfang an um den vergeblichen Versuch, die Vergangenheit einzufrieren, der hier erst später eine Rolle spielt. Zunächst geht es ja darum, dass Quentin in seine gleichaltrige Nachbarstochter Margo verschossen ist, die beiden gleich zu Beginn gemeinsam einen Toten finden (Anknüpfungspunkt an Still the Water) und sich daraus der spezielle, fast mythische Reiz Margos entwickelt: »She loved mysteries so much that she became one.« Eine ausgedehnte Zeitlupenstudie ist aber eher das genaue Gegenteil eines Mysteriums.
Und so wird aus Quentins Mantra »I don't want to get in trouble« der Grund, warum sich die beiden immer weiter voneinander entfernen. Er wird zum Nerd (was man dem Schauspieler trotz Pokemon-Titellied-Singen nicht abnimmt) und sie zum Dreh-und Angelpunkt einer von außen beliebt wirkenden Clique, die dann aber von Margo als oberflächlich und dumm auseinandergenommen werden, als ihr Jock-Freund sie sitzen lässt und Margo sich in einer schicksalhaften Nacht gemeinsam mit ihrem ersten Komplizen an allen möglichen Mitschülern rächt.
Diese Racheaktion stellt der Film wie eine supertolle Aktion dar, witzig und rebellisch – aber das funktioniert so gar nicht. Dazu bekommt man als Zuschauer auch einfach nicht genügend Informationen, und um zwischen Gut und Böse entscheiden zu können. Wer wie Quentin andere mit Nacktfotos »defensiv« erpresst, ist doch auch nur ein oberflächlicher mieser Bully – daran ändert auch Margos sehr modisch wirkender Kapuzenpulli oder das zorro-mäßige M wenig. Dieser Punkt wird aber nur sehr vage und viel später mal angerissen, wenn etwa Margos ehemals beste Freundin, die sie vermeintlich »hintergangen« hat, sich im Nachhinein als ganz normal und durchaus sympathisch erweist.
Die Höhepunkte dieser »großartigsten Nacht seines Lebens« sind übrigens zwei wegen (sehr unglaubwürdiger) Spraydosen-Benutzung blaue Fingerspitzen, die sich berühren und ein auf Romantik hochgefahrener Blick auf die Skyline, zu der man die Muzak-Kenny-G-Fassung von Chris De Burghs »The Lady in Red« hört. Schudder! Ach ja, und wer's nicht kapiert hat: Margo trägt später in einem Traum auch mal ein rotes Kleid! Clever ist was anderes.
In der zweiten Hälfte des Films geht es darum, dass Margo verschwunden ist und es jetzt an Quentin liegt, sie über versteckte Hinweise wiederzufinden. Margos Mutter fasst das mittlerweile fünfte Von-Zuhause-Weglaufen ihrer nunmehr 18jährigen Tochter lapidar zusammen: »She's bored – she wants attention.« Ganz auf die jugendlichen Zuschauer zugeschnitten werden die nicht ausreichend besorgten Erziehungsberechtigten als besonders schlechte Eltern dargestellt – aber die Mutter hat offensichtlich ja Recht!
Der Rest des Films ist eine unglaubwürdige Schnitzeljagd kurz vor dem Schulabschlussball – und für die Suche nach »Margos Spuren« schwänzen Quentin und seine beiden besten Freunde auch erstmals die Schule – nur um dann mit zwei unterschiedlich zufällig dazustoßenden weiblichen Begleitungen wichtige Lebenseinsichten dargeboten zu bekommen. Wie eine Mischung aus Ferris Bueller's Day Off und The Da Vinci Code – leider qualitativ eher am letztgenannten Film angelegt.
Nebenbei gibt es einen reichlich plakativen Vergleich mit Moby Dick (Quentin muss begreifen, dass er einem weißen Wal hinterherjagt), Margo mag offenbar die Gedichte von Walt Whitman und die Musik von Woody Guthrie – aber das wirkt alles wie eine verlogene Anbiederung beim Bildungsbürgertum (was mir in The Fault in Our Stars nicht so deutlich vor Augen geführt wurde).
Verheerend ist natürlich: Wenn man sich erst mal aufregt, findet man noch immer mehr: einen unglaubwürdigen verlassenen Laden, die Schnitzeljagd, die immer bekloppter wird und auch nicht durch den Schlussgag gerettet werden kann – oder beispielsweise Glasbilderrahmen, die direkt über einer Badewanne hängen. Außerdem sind manche Gags längst nicht so geschmackvoll wie in The Fault.
Und am schlimmsten fand ich dann die Sphärenmusik beim lang erwarteten Wiedersehen (der Soundtrack ist sonst im Großen und Ganzen okay), bei dem man dann auch wieder dick und fett mit Zeitlupe arbeitet.
Eine Woche später habe ich mich halbwegs abgeregt, aber das war schon eine arge Enttäuschung. Und man konnte fast jede Entscheidung des Buchs ganz genau nachvollziehen, wie am Reißbrett entworfen. Keinerlei Überraschungen. Wer mit John Hughes statt mit John Green aufgewachsen ist, hat es irgendwie besser erwischt.
Aber: Wer nur Dan Brown und Stephenie Meyer liest, ist mir immer noch lieber als jemand, der gar nichts von Büchern hält. Also: lassen wir den Kids den Spaß!
 |
Still the Water
(Naomi Kawase)
Originaltitel: Futatsume no mado, Japan / Spanien / Frankreich 2014, Buch: Naomi Kawase, Kamera: Yutaka Yamazaki, Schnitt: Tina Baz, Naomi Kawase, Musik: Hashiken, Art Direction: Kenji Inoue, mit Nijirô Murakami (Kaito), Jun Yoshinaga (Kyoko), Miyuki Matsuda (Isa), Tetta Sugimoto (Toru), Makiko [oder Makika?} Watanabe (Misaki), Jun Murakami (Atsushi), Hideo Sakaki, Sadae Sakae, Kazurô Maeda, Mitsuaki Nakano, Yukiharu Kawabata, Yukiyo Maeda, Kinue Yasuda, Fujio Tokita, 121 Min., Kinostart: 30. Juli 2015
Japan gehört zu meinen bevorzugten Filmnationen, und gerade das betont langsame Tempo des asiatischen Arthaus-Kinos ist eine willkommene Abwechslung zum meistens diametral angelegten westlichen Kino. Das bedeutet aber (leider) nicht, dass jeder japanische Film automatisch bei mir die Glückshormone ausschüttet, und Still the Water ist leider ein Beispiel dafür, dass zwei Stunden Kino seeeehr lange wirken können.
Konzeptionell ergibt alles Sinn: Eine Coming-of-Age-Geschichte um eine junge Freundschaft / Liebe wird mit dem Thema Tod kombiniert (die alte Eros-Thanatos-Kiste), zunächst mit dem Fund einer Leiche (Stand by Me lässt grüßen!), dann mit dem episch ausgewalzten Abschiedsritual für die todkranke Mutter. Und das Wasser ist das verbindende, allgegenwärtige Element, in dem einerseits der mysteriöse tätowierte Körper treibt (der dem Film vielleicht zu früh zu einem Adrenalinstoß verhilft, der nie seine Bestimmung findet) und andererseits sexuelle Wonnen locken.
Die Verbindung zwischen den Elementen Tod, Sex und Wasser wird schon sehr früh eingeführt, dem Meeresrauschen und der Brandung folgt Ziege, der die Kehle durchgeschnitten wird. Das steht auch für die Naturverbundenheit der subtropischen japanischen Insel Amami, über die man vermutlich mehr wissen muss, um den Film besser zu schätzen.
Es geht weder um den Mordfall noch um Realität, denn spätestens wenn Kyoko (Jun Yoshinaga) in ihrer Schuluniform dort taucht, wo es wegen des Leichenfundes verboten ist, behält sie sogar die Socken an. Das soll vielleicht etwas über die noch nicht ausgelebte Sexualität der 16jährigen aussagen, aber wenn sie damit etwas später zur Schule geht, würden – Subtropen hin oder her – vermutlich die Schuhe ein lustiges und unangenehmes Plitsch-Platsch von sich geben.
Kaito (Nijiro Murakami), die männliche Hauptfigur und der Finder der Wasserleiche mit dem Yakuza-Drachentattoo diskutiert mit Kyoko erst mal über philosophische Grundsatzthemen. Sie: »Warum ist es so, dass die Leute geboren werden und sterben?« Er: »Dafür gibt es keinen Grund.« Auf etwas höherem Niveau geht es dann mit einer Frauenstimme aus dem Off weiter, während die Kamera nebenbei kleine Tiere einfängt. Fehlt nur noch Elton John und sein Circle of Life.
Der Fokus der Geschichte verlagert sich nebenbei langsam auf Kyokos Mutter, womöglich auch, weil die Liebesgeschichte nicht so recht in Fahrt kommt, weil Kaito einfach zu trantütig ist. Kaito: »Das Meer macht mir Angst. Es ist lebendig!« Kyoko: »Ich bin auch lebendig …« Kurz gesagt: wenn sie nicht die Initiative übernommen hätte, wäre nie etwas passiert und er würde sie noch Wochen später auf seinem Gepäckträger stehend durch die Gegend chauffieren, während er deutlich schnauft und sie hübsch grinst – was aber auf lange Sicht auch nicht satisfaktionsfähig ist.
Und durch die etwas wirr wirkende Monologe der Mutter (eine Seherin!) über Kinderkriegen und den Tod (mal wieder!) soll das Ganze mit Bedeutung aufgeladen werden. Was zumindest bei mir überhaupt nicht funktioniert hat.
Des Nachts taucht dann ein verschwitzter Mann mit Drachentattoo auf und treibt es mit einer jungen Frau. Alles sehr mysteriös, evtl. auch nur ein Traum Kaitos.
Und weil das Erzähltempo noch nicht gemächlich genug war, besucht Kaito am nächsten Tag mal seinen Vater (die Eltern leben getrennt, was der zartbesaitete »Tokyo Boy« noch nicht ganz verarbeitet hat – deshalb vielleicht auch die Zurückhaltung im Umgang mit dem anderen Geschlecht). Und siehe da: Papa Atsushi arbeitet als (Trommelwirbel!) Tätowierer. Leider hatte ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits größtenteils aus dem Film verabschiedet und habe nur noch das Ende erwartet. Von drei wichtigen Storypunkten war bisher nur einer abgearbeitet: ein vorausgekündigter Taifun (Wasser und so, ihr wisst schon). Auf Kaitos möglichen ersten Sex und den Tod der Mutter muss man noch lange warten, meine Erwartung an die Auflösung des Todesfalls habe ich längst heruntergeschraubt, und falls im Dialog mit dem Vater subtil irgendetwas angedeutet wurde, tut es mir leid. Die Voice-Over (jetzt vom Papi, der vom Schicksal faselt) gepaart mit einer sehr anstrengenden Wackelkamera, die Straßenszenen einfängt, hat nicht nur meine Augen strapaziert, sondern vor allem meine Geduld.
Dann baden Papa und Sohn noch gemeinsam, mit Einseifen und natürlich einem Drachentattoo! Außerdem erwähnt Papi noch, dass Sohnemann seiner Mutter verteufelt ähnlich sieht. Aber ich bin längst zu faul, mir auch noch über so eine umgekrempelte Ödipus-Kiste Gedanken zu machen.
Die beste Stelle des Films ist vermutlich das Abschiedsritual, mit dem man sich von der Mutter (und Seherin!) verabschiedet. Unter anderem auch, weil der Tod natürlich nicht immer dann eintrifft, wenn es irgendwem gerade gut passen würde. Aber da dieses Prinzip schon den ganzen Film lang arg ausgereizt wurde (und nicht unerheblich an der Lauflänge beteiligt ist) und zum gefühlt 31sten Mal ein Lobgesang auf den Kreislauf des Lebens, die Kraft des Meeres und der Wellen etcetera pp angestimmt wird, breche ich meinen Bericht an dieser Stelle ab. Soviel sei verraten: die »Auflösung« bestimmter Storyelemente konnte für mich auch nichts mehr retten.
Filmzitat: »Der Natur gegenüber muss man sich bescheiden geben. Es ist sinnlos, sich zu widersetzen.« Vermutlich gilt das auch für den Film selbst, aber mir fehlt einfach die sittliche Reife, das ganze esoterische Symbolgedöns zwei Stunden lang zu ertragen und dann auch noch so zu grinsen wie Kyoko auf dem Gepäckträger.
Einmal macht sie sich übrigens absichtlich hinten auf dem Drahtesel schwer und fällt dann auch vom Rad. Kaito fragt besorgt, ob sie sich verletzt hat, sie antwortet nur knapp »Mein Herz!«
Aua! (aber für gefühlt vier von fünf Kritikern hohe Filmkunst mit wichtigen Themen)
 |
Station to Station
(Doug Aitken)
USA 2014, Kamera: Doug Aitken, Corey Walter, Schnitt: Austin Meredith, Regisseure des zweiten Stabs: Todd Krolczyk, Austin Meredith, mit Thurston Moore, Jackson Brown, Patti Smith, Dan Deacon, Giorgio Moroder, Doug Aitken, Bloodbirds, Beck, Mavis Staples, Cat Power, Lawrence Weiner, William Eggleston, Urs Fischer, Olafur Eliasson, Thomas Demand, THEESatisfaction, The Congos, Christian Jankowski, Sam Falls u.v.a. 70 Min., Kinostart: 16. Juli 2015
In der Einladung klang alles ziemlich interessant: Eine Bahnfahrt quer durch die USA (vom Atlantik zum Pazifik), auf dem Weg zehn Bahnstationen mit »unique happenings« zwischen Kunst und Musik, unter den Mitwirkenden echte Stars wie Patti Smith, Beck oder Thurston Moore … und (eigentlich am ansprechendsten) der ganze Film soll in 62 »Mini-Movies« von je einer Minute Länge aufgeteilt sein, wodurch eine besondere Kurzweiligkeit garantiert scheint – und eine Menge Abwechslung.
Pustekuchen!
Nach einem ausgedehnten Vorspann, in dem alle diese Infos noch mal in prägnanten Schlagzeilen-Zwischentiteln erklärt wurden (außerdem das Detail, dass die ganze Fahrt 24 Tage gedauert hat), kommt Film Nr. 1 (»This is a Happening«), indem Regisseur Doug Aitken noch mal detailliert alles erklärt und mit »Teasern« versucht, einem den Mund wässrig zu machen. Übrigens reichlich vergeblich. Film 1 ist also schon mal kein Film, sondern eine Art Trailer für den Film, in dem man doch bereits schon sitzt. Das ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man den Film in der Glotze sieht und davon abgehalten werden soll, umzuschalten – oder wenn man irgendwann vom 9. Juli bis 27. September in einer Kunsthalle in Frankfurt den Film sieht, wo er eine offenbar recht große Ausstellung des Künstlers Aitken begleitet / unterstützt. Aber auch da hat man das Ticket ja längst bezahlt und es stellt sich höchstens die Frage, ob man das Werk des Künstlers (vor allem Skulpturen und Sound- oder Filminstallationen) selbst erkunden will oder erst mal ein Filmchen schauen.
Aber zurück zu den 62 Mini-Movies. Nr. 2 mit dem Titel »Smokebomb« zeigt exakt das: eine bzw. zahlreiche bunte Rauchbomben, eine Menge Großaufnahmen von angerissenen Streichhölzern und immer wieder den eingeschnittenen nächtlichen Zug, der durch eine besondere Lichtinstallation das Element Geschwindigkeit besonders betont. Das sah man aber auch schon während des Vorspanns und Film 1 mehrfach.
Ich will es kurz machen: Es gibt gar keine »Mini-Movies«, denn alle Filme sind vom selben Regisseur, funktionieren mit den selben, oft extrem nervenden Inszenierungsmitteln, und die Nummern und Titel dazwischen führen einem nur schmerzhaft vor Augen, wie lange es noch bis zum »Bergfest« dauert. Manche Künstler (z.B. Thurston Moore oder Patti Smith) haben es einfach verdient, zwei »Filme« zu bekommen, meistens einmal eine (auch schon recht gekürzte) Song-Performance und ein Interview. Wenn Performer wie Dan Deacon oder dieser in Sprechgesang verfallene Auktionator gar an zwei Stellen im Film »ihr« Filmchen zugesprochen bekommen, wird außerdem das ganze Prinzip »vom Atlantik zum Pazifik« verraten (man erfährt jedenfalls fast nie, wo man sich wann befindet, wann eine Station beendet ist und die nächste beginnt), und die Sache mit den Minifilmen fruchtet allerhöchstens dann, wenn gefühlt jeder elfte Film in Schwarzweiß gedreht wurde und dadurch von dem davor und dem dahinter etwas deutlicher zu unterscheiden ist. Stattdessen immer wieder die sehr ähnlichen Bilder des Zuges (von der Seite meistens Nachts, aus einem bestimmten Panoramawagen bevorzugt am Tag), Liveaufnahmen mit sehr ähnlichen Filminstallationen auf immer gleich positionierten drei Leinwänden (bloß nicht den Künstlern selbst die Möglichkeit geben, sich auszudrücken) und, was mich schon reichlich erzürnte, Kurzvorstellungen von oft unbekannten Bands, die sich in eher ideenlosen Musik-Clips erschöpften, wobei man (zu wenige Kameras?) nur sehr selten auch den Ton hörte, der zum Bild gehört. Zwar haben einige der Musiker (etwa auch Giorgio Moroder) sogar direkt im Zug performt, aber meistens hört man dazu eine Playbackaufnahme und sieht bevorzugt Zeitlupeneinstellungen mit vermeintlich künstlerischen Motiven. Und wenn man schon über so einen Film die Chance bekommt, ein größeres oder zusätzliches Publikum zu finden (ich fand beispielsweise die Bloodbirds ziemlich toll und habe mir schon ein paar Songs von ihnen auf youtube angehört), dann sieht man manchmal nur zwei oder drei bewegte Photoshootings, einen Interviewausschnitt mit manchmal erschreckend blöden Fragen – und das war's dann auch schon wieder. Außerdem wurden offenbar alle Künstler einigermaßen festgelegt auf Songs, die etwas mit Zügen oder Geschwindigkeit zu tun haben sollten.
Den Künstlern oder Fotografen erging es auch nicht viel besser, und wenn man den Nachspann aufmerksam betrachtet (hier kann man übrigens alle 62 Filme noch mal Revue passieren lassen, weil man wohl irgendwie auf Gedeih und Verderb auf 70 Minuten Lauflänge kommen wollte), dann sieht man außerdem, dass Gevatter Aitken eine nicht geringe Anzahl seiner eigenen Werke aus den eins, zwei Jahren davor einfach noch mal recyclet hat. »Das ist mein Film, da kann ich machen, was ich will« hätte Donald Duck das zusammengefasst.
Alles in allem: Ein vermutlich reich gefördertes Selbstbeweihräucherungs-Projekt, das gerade auf filmischer Ebene nur sehr selten überzeugt und eher wie ein missglücktes Montage-Experiment daherkommt. Man will angeblich die Kreativität an sich feiern, ist aber dabei in der eigenen unfassbaren Konventionalität gefangen. Und wer insbesondere nur ins Kino geht, weil er oder sie großer Fan von Beck oder Patti Smith ist, der kann getrost zuhause bleiben und sich lieber eine alte Scheibe auflegen. Jackson Browns Sprechgesang an einem Bahnsteig ist noch einigermaßen gelungen und Thurston Moore war auch toll, aber dafür drückt man ja keine 8 Euros ab. Außer, man hat nun ganz und gar nichts besseres zu tun. Von meinem Filmwissen her, meinem Musikverständnis und meine Auffassungsgabe für Kunst ein komplett überflüssiger und auch ziemlich öder Streifen. Bezeichnend finde ich auch den Blurb, den man für Werbezwecke nutzt: »Doug Aitken lässt die Kunst durch das Land fahren« schrieb »Art – Das Kunstmagazin«. Das man in diesem Statement abgesehen von der wohl übereinstimmenden Definition für Kunst keine Wertung findet, spricht Bände.
Ach ja, und bevor ich es vergesse: die schlechtesten Untertitel seit langem. Nicht nur wegen oft überflüssiger und manchmal unpassender Übersetzungen, sondern vor allem, weil die Untertitel etwa zwei Sekunden zu früh einsetzen. Die »Filmnummern« und Titel sieht man deshalb z.B. immer zuerst in der Übersetzung, bevor sie dann im Original quasi »nachgeliefert« werden. Autsch! Falls das aus irgendwelchen Gründen am Projektionisten oder ähnlichem liegt, entschuldige ich mich an dieser Stelle auch bei Veronika Sandkühler von Babelfisch Translations. Aber nur dann.
Bald in Cinemania 134 (Therapiegründe):
Aloha (Cameron Crowe), Boy7 (Özgür Yildirim), Broadway Therapy (Peter Bogdanovich), Las insoladas – Sonnenstiche (Gustavo Taretto), Therapie für einen Vampir (David Ruehm), The Vatican Tapes (Mark Neveldine).
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 133:
133: