
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
13. Juni 2018 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||
|
|
|
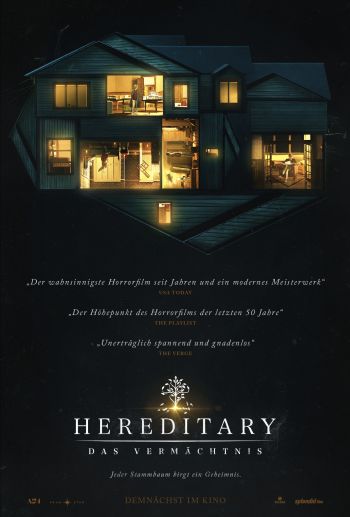 |
Hereditary -
Das Vermächtnis
(Ari Aster)
Originaltitel: Hereditary, Buch: Ari Aster, Kamera: Pawel Pogorzelski, Schnitt: Jennifer Lame, Musik: Colin Stetson, Kostüme: Olga Mill, Production Design: Grace Yun, mit Toni Collette (Annie Graham), Gabriel Byrne (Steve Graham), Alex Wolff (Peter Graham), Milly Shapiro (Charlie Graham), Ann Dowd (Joan), 123 Min., Kinostart: 14. Juni 2018
Ein Trend im modernen Mainstreamkino, den Freunde der eigentlichen Filmkunst mitunter als frustrierend empfinden, ist die Neigung dazu, sich immer wieder übertreffen zu wollen, etwas nie da gewesenes zu präsentieren. Ich habe das erstmals bei den Mission-Impossible-Filmen konkret wahrgenommen, in denen man mit einem Hubschrauber durch den Kanaltunnel flog, um dort einen Hochgeschwindigkeitszug zu verfolgen. Weil technologisch mittlerweile alles machbar scheint, was man sich nur vorstellen kann, hat man das Gefühl, dass diese kaum fassbare Grenze des Denkbaren auch ausgelotet werden muss.
Früher waren die Helden gutaussehend und körperlich perfekt austrainiert, heutzutage ist jeder ein Superheld, selbst, wenn er nicht in einem Marvel-Film mitspielt. Wo man in den Neunzigern immer größere Explosionen und komplexe Stunts bemühte, werden nun 9/11-Szenarien mehrfach für den selben Showdown bemüht, Metropolen werden zusammengefaltet wie Origami-Papier, James Cameron dreht diverse Jahre an den nächsten paar Avatar-Filmen usw.
Im Horrorfilm, der seit den 1970er nicht mehr so nah am Mainstream war wie heutzutage, gibt es aktuell nicht mehr nur Bemühungen, immer abstrusere Splattereffekte zu ersinnen, man erkennt auch Bestrebungen, das mittlerweile abgestumpfte Genrepublikum zusammen mit den normalen Zuschauern durch an der Realität orientierte besondere Schockmomente aktiv in besondere Angst zu versetzen. Und gleichzeitig wird das Horrorkino auch intelligenter als je zuvor, die relevante Parabel hinter all dem Grusel ist nicht mehr nur eine Zusatzleistung für einige Spezialisten, das gesamte Publikum diskutiert über die tieferen Bedeutungen einer Geschichte. Und auch hier wird beim ultimativen Twist, der durch die sich anpassenden Zuschauer immer schwieriger erreicht werden kann, immer noch einer draufgesetzt. Wobei ich immer an M. Night Shyamalan denken muss, der als Einzelperson sehr schnell an seine Grenzen stieß, während hier die gesamte Branche sich zu übertreffen droht, aber den Vorteil hat, dass man beim Erreichen eines gewissen Sattelpunkts, wo das Sich-selbst-übertreffen nicht mehr zur allgemeinen Zufriedenheit erreicht wird, nicht wie ein einzelner Filmemacher als »überholt« abgelegt wird, sondern immer wieder nachwachsende Generationen den narrativ-qualitativen »Rekord« zu brechen versuchen.
Noch gelingt das einigermaßen, aber es bleiben dabei auch viele Mitbewerber unterschiedlich kläglich am Straßenrand liegen. Was im Horrorfilm mit oft eingeschränktem Zielpublikum und geringeren Budgets nicht das selbe Problem darstellt wie im Blockbusterkino, wo zwar schon länger mehr kein ganzes Studio nach einem monumentalen Flop kollabiert, aber ein Zurückbleiben hinter den immer größeren Erwartungen (Solo: A Star Wars Story) schnell zum großen Problem wird, bei dem die kreativen Köpfe rollen. Was natürlich auch die Filmemacher mit eher bescheidenen Ansprüchen betrifft (etwa Colin Trevorrows The Book of Henry und seine Entlassung für den Blockbuster danach).
Ich wuchs mit dem Kino der 1970er auf und mag auch die kleinen Filme, die heute immer seltener gedreht werden. Ein 15 Jahre jüngerer guter Freund schockte mich letztens mit seiner zugespitzten Zusammenfassung seiner Kinovorlieben: »Wenn keiner fliegen kann oder ein Alien ist, interessiert es mich nicht.«
Eine lange Vorrede, deren Bezug zum behandelten Film sich nicht auf Anhieb offenbart.
Hereditary, ein Debütfilm eines Regisseurs, der sich mit Kurzfilmen einen Namen machte (gerade bei Horrorfilmen eine sich immer häufiger wiederholende Karriere), versucht alles gleichzeitig richtig zu machen. Wir haben einen vergleichbar »kleinen« Film mit einem hochkarätigen Cast für »überdurchschnittliche« Kinogänger (Toni Collette und Gabriel Byrne sind keine Superstars, aber wer oft genug ins Kino geht, kennt sie und lernte ihre Fähigkeiten zu schätzen).
Schon in den ersten Einstellungen eröffnet der Film ein Metaspiel, denn man lernt das in einer Waldszenerie liegende Haus kennen, in dem der folgende Film zu großem Teil spielen wird. Und zwar, weil darin eine kleine Modelversion selbigen Hauses steht. Die Kamera stößt nun ins Haus im Haus vor, und eine eigentlich unbedeutende »Weck-den-Teenager-auf«-Szene bekommt dadurch, dass sie in dem Winzzimmer stattfindet, gleich einen surrealen Touch, der die Realität ins Kippen bringt.
Zunächst weiß man nicht, was diese Szene bedeuten / symbolisieren soll. Gibt es hier tatsächlich Minimenschen à la Downsizing? Schaut hier eine unheimliche Macht auf ihre symbolisch kleinen Opfer wie Jack Nicholson auf Frau und Kind im Modell des Heckenlabyrinths in The Shining? Oder geht es eher darum dass jemand (und der Zuschauer nimmt diese Perspektive auf) halluziniert?
Der Regisseur und Autor Ari Aster löst diese Frage nicht auf. Nicht einmal im Presseheft, wo er eine mehrere Szenarien umfassende Allgemeinbeschreibung im Interview absondert: »Die Grahams sind wie Figuren in einem verfluchten Puppenhaus, die von äußeren Kräften manipuliert werden.«
Das »Puppenhaus« als solches erfährt zumindest eine Erklärung auf der Realebene: Mutter Annie Graham (Toni Collette) ist eine bedeutende Künstlerin, die Miniaturen mit autobiographischem Bezug fertigt (was im Verlauf des Films nicht unbedingt auf ihren vorbildlichen Seelenzustand verweist).
Aber Regie und Buch liefert hier keine hübsch akkurate Abarbeitung verschiedener Gruselmomente, die sich vielleicht als harmlos erweisen könnten, sondern liefert das, was man im Kriminalgenre als red herrings bezeichnet: Zahlreiche Hinweise darauf, warum dieser Film (und seine Handlung) im Horrorgenre angesiedelt sind, wobei man als Zuschauer (Standard der letzten zwanzig Jahre) darüber rätselt, was jetzt zutrifft oder wichtig ist und womit im Zusammenhang steht, während man natürlich auch immer wieder auf falsche Fährten geschickt wird als beobachtender Detektiv in diesem »verfluchten Puppenhaus«.
Aufgrund des Titels sehr wahrscheinlich von Bedeutung ist die gleich zu Beginn gelieferte Todesanzeige: die 78jährige »Oma« der Familie ist soeben verstorben, in der Familiengeschichte häufen sich schwer erklärliche Todesfälle. Während Annie im Verlauf des Films Bücher wälzt (entweder über seltsame Phänomene oder aus dem Nachlass ihrer Mutter), verhält sich Annies Tochter Charlie (Milly Shapiro) seltsam bis bedrohlich, der etwas ältere Sohn Peter (Alex Wolff) ist wohl in einer rebellischen Phase und die Ehe mit Steve scheint unübersehbare Probleme zu haben.

© Splendid Film
Und dann dreht Ari Aster die Daumenschrauben, in denen in diesem Film nicht nur die Familienmitglieder, sondern auch unsereins als Zuschauer festhängen. Charlies psychologische Probleme wachsen sich aus, es kommt zu einem Todesfall, und die verbliebenen drei Familienmitglieder, traumatisiert und entfremdet, machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle, während sie größtenteils unabhängig voneinander immer mehr Hinweise darauf entdecken, dass sie wohl nicht alleine in diesem Spukhaus sitzen.
Mit Schocks, die an die postklassischen psychologischen Horrorfilme der 1970er erinnern (so was vom Schlage The Exorcist oder Rosemary's Baby, die damals noch die Kinowelt in Aufruhr versetzen) liefert Aster nach einer enervierenden tour de force zwar ganz gut durchdachte und in der nachfolgenden Analyse stimmige »Erklärungen«, was während des Films geschehen ist, aber ungeachtet einiger auch inszenatorisch wirklich starken Momente funktioniert die Kombination infernalisches Familiendrama mit übersinnlichem Spukhaus für mich nicht wirklich. Man ist als Zuschauer einerseits emotional angespannt durch die teilweise nicht nachvollziehbaren Handlungen der miteinander konkurrierenden Familienmitglieder, versucht nebenbei zu ergründen, worum es hier eigentlich geht. Und nebenbei geht die Spannung zwar nicht flöten, man verliert aber den emotionalen Bezug, distanziert sich, vielleicht auch als Eigenschutz (man hat ja gerade miterlebt, wie man traumatisiert werden kann und will den Figuren dabei nicht unbedingt folgen). Die Figuren, um deren Leben man bangen sollte, sind mittlerweile einfach zu kirre, nach der ersten Leiche und den repercussions ist die Fallhöhe so hoch, dass man sicher ist, dass es kein hübsches Happy-End geben wird - und man fühlt sich ein wenig wie ein (im günstigsten Fall faszinierter) Gaffer bei einem schrecklichen Autounfall. Das ist zwar das Zeug, aus dem Alpträume gewoben werden (und man fühlt sich im Kinosessel durchaus unwohl), aber das Erlebnis entspricht in meinen Augen keiner cinematographischen Meisterleistung (wie es einige Kollegen darstellen), sondern eher einem irgendwie mauen Gefühl in der Magengegend, bei dem gerade die finalen Handlungstwists eher etwas nerven.
Mir fehlen ein wenig die Worte, zu beschreiben, auf welche Art der Film versagt, mich mitzureißen, aber ähnlich empfand ich jüngst bei Aronowskys mother!: Alles ist so schrecklich und so clever ausgedacht, aber es berührt mich nicht, sondern nervt irgendwie.
Vermutlich gibt es eine gewisse Schnittmenge zwischen Leuten, die Hereditary oder mother! beide superduper finden, ich gehöre zur wohl auch nicht geringen Schnittmenge jener Leute, die beide Filme als nicht so gelungen, sondern auf eine anstrengende Weise prätentiös einstufen. Hereditary ist dabei aber noch der klar interessantere Film und ich werde mir den nächsten Ari-Aster-Film sicher wieder anschauen, während mother! für mich schon in Richtung Antichrist geht und ich Filme des hauptberuflichen Provokateurs Lars von Trier (ich war damals ein Riesenfan von Breaking the Waves und Dancer in the Dark) mittlerweile meide (bei Aronofsky warte ich noch ab, bin aber skeptisch).
Der Gegenentwurf zu Hereditary ist für mich übrigens Get Out: Den finde ich thematisch und inszenatorisch super, mich nervt nur die angestrengte (und irgendwie alberne) »Erklärung«, die für den Film ein Fundament liefern soll (ein bisschen, wie ich jeden Stephen-King-Roman lese, aber auf die abgedrehten Aliens in Tommyknockers oder Dreamcatchers oder die Entwicklung bei Cell sehr gut verzichten kann). Bei Hereditary überzeugt mich die bloße Handlung (das, was man im Nachhinein konstruiert und wo man jetzt spoilern müsste) auch nicht, und mein Unwillen darüber zieht das Gesamturteil nicht nur etwas in die negative Richtung, sondern macht auch einiges an tatsächlich gelieferten Leistungen für mich im Urteil zunichte. Vielleicht wie bei einem Fußballspiel. In manchen Fällen ist es ein Trauerspiel, aber man sagt sich: »Immerhin haben wir gewonnen«, in anderen Fällen (Gruß an Andreas!) schließt man nach dem Spiel mit der Sportart komplett ab (so wie ich mit manchen Regisseuren) und ist sauer. Letzteres ist dann der Antichrist-Fall, aber Hereditary geht schon etwas in die Richtung.
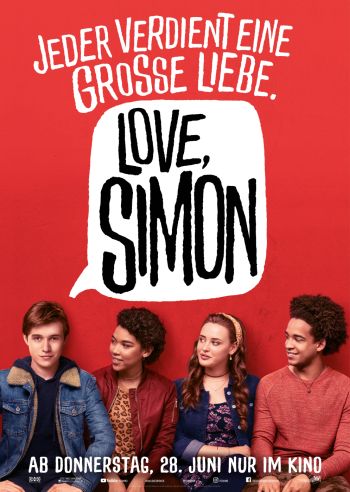 |
Love, Simon
(Greg Berlanti)
USA 2018, Buch: Elizabeth Berger, Isaac Aptaker, Lit. Vorlage: Becky Albertalli, Kamera: John Guleserian, Schnitt: Harry Jierjian, Musik: Rob Simonsen, Musik Consultant: Jack Antonoff, Kostüme: Eric Daman, Production Design: Aaron Osborne, mit Nick Robinson (Simon Spier), Jennifer Garner (Emily Spier), Josh Duhamel (Jack Spier), Katherine Langford (Leah), Alexandra Shipp (Abby Suso), Logan Miller (Martin), Keiynan Lonsdale (Bram), Jorge Lendeborg, jr. (Nick), Talitha Bateman (Nora Spier), Tony Hale (Mr. Worth), Natasha Rothwell (Ms. Albright), Patrick Donohue (Math Teacher), 110 Min., Kinostart: 28. Juni 2018
Es passiert öfters mal, dass mich die Lobgesänge und überschwenglich guten Kritiken für bestimmte Filme befremden (Blade Runner 2046 ist das Beispiel, das mir auf Anhieb einfällt). Bei Love, Simon ist man darüber begeistert, dass wohl zum ersten Mal eine von einem großen Hollywood-Studio geschaffene Highschool-Komödie eine offen schwule Hauptfigur hat. Wohlgemerkt, nur in Kombination dieser drei bis vier Teilaspekte wird etwas »besonderes« daraus.
Verglichen damit ist die Nachricht, das Frauen seit neuestem in Saudi-Arabien den Autoführerschein machen können / dürfen, tatsächlich so etwas wie ein »Fortschritt«. In beiden Fällen ist es eigentlich die lange Zeit vorherrschende Rückständigkeit, die die »Neuigkeit« ermöglicht, aber in Saudi-Arabien kann ich mich für die Frauen mitfreuen, während ich beim Fall Love, Simon implizit eigentlich das Schicksal jener Kinozuschauer beweinen muss, die halt nicht auf die Idee kamen, sich beispielsweise Independent-Highschool-Komödien anzuschauen (auch, wenn ich keine konkreten Zahlen oder dutzendweise Filmtitel liefern kann, bei denen alle anderen Teilaspekte aufeinander trafen, zumindest Lukas Moodyssons Fucking Åmål ist beispielsweise aus dem Jahre 1998).
Aus meiner Sicht ein kleines Ärgernis ist es, dass Love, Simon als Highschool-Komödie eher unterdurchschnittlich ausfällt, die bloße Innovation, die ich im ersten Absatz meines Textes ausführlich erklärte scheint für manche Schreiberlinge bereits auszureichen, um den Film positiv hervorzuheben.
Dabei gibt es im Film einige Holprigkeiten, die auch für geneigte Zuschauer ärgerlich ausfallen. Es geht damit los, dass sich der vor seinem Coming-Out stehende Simon (Nick Robinson, Jurassic World) scheinbar deshalb in einen anonymen (!) Schulkameraden verliebt, weil der ihm Unbekannte sich zu Beginn des Films auf der Website »CreekSecrets« anonym outete (?!?) und schon die bloße Information, dass es einen zweiten (streng genommen dritten) Homosexuellen auf der Schule gibt, macht »Blue« (so der Tarnname) zum unbedingt zu erreichenden love interest - völlig unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild (Simon ist natürlich supertolerant und steht auf innere Werte) oder sonstigen Vorlieben, Talenten oder Hobbys.
Ein wichtiger Handlungsstrang des Films ist Simons Suche nach Blue, wobei er sich mehrfach »verdächtige« Schulkollegen vorstellt, während er die neuesten Nachrichten seines anonymen Mailfreundes liest. Die zweite Haupthandlung besteht darin, dass der (immer noch nicht geoutete) kompromittierende Teile seiner Mailkommunikation aus den Augen verliert und der etwas peinliche Klassenkamerad Martin (Logan Miller, Scout's Guide to the Zombie Apocalypse) Simon mit seinem Wissen dazu animiert (der Fachbegriff lautet Erpressung), ein gutes Wort bei Logans Hetero-Freundin Abby für ihn einzulegen.
An dieser Stelle muss ich kurz erklären, dass Simon drei gute Freunde auf der Schule hat, mit denen er z.B. auch zusammen zum Unterricht fährt: Die neu dazugestoßene Abby, die sich auf Anhieb mit Simons Fahrgemeinschaftler / Freund Nick sehr gut versteht. Und dann fehlt nur noch Leah, die seit längerem in Simon verschossen ist, was dieser natürlich nie realisiert hat. Beste Voraussetzungen, um es sich mit allen Freunden gründlich zu verscherzen, denn nicht nur stößt er Leah vor den Kopf, sagt ihr aber nicht den Grund dafür - unter Martins Druck sabotiert er auch die knospende Liebe zwischen Abby und Nick.
All dies lässt Simon nicht unbedingt supersympathisch erscheinen, vor allem, wenn man bedenkt, dass er durch ein Statement über seine sexuelle Orientierung all seine Probleme schnellstens korrigieren könnte. Als ich mit meiner Bekannten Katharina im Kino den Trailer zum Film sah, den ich damals schon kannte, war sie aufgrund der Ausschnitte etwas verwirrt und fragte mich, in welchem bereits etwas zurückliegenden Jahrzehnt der Film den spielen soll. Die schwer zu glaubende Antwort: Love, Simon soll heutzutage spielen, auch wenn sich seit den 1980ern ja schon hier und da etwas getan hat mit der Inklusion von Schwulen und Lesben.
Regisseur Greg Berlanti, u.a. bekannt als Show Runner von Fernsehserien wie The Flash oder Riverdale, erzählt seinen Film aber so, als hätte es nie zuvor einen Film über dieses Thema gegeben. Noch blöder wird es dann, wenn etwa zwei Bullys erst homophobe Witze reißen, dann vom Kollegium verwarnt werden und augenblicklich alle Schüler parademäßig tolerant auftreten (die Situation hat sich bis zum aktuellen Jahr sehr verbessert, ist aber längst noch nicht ideal) oder Simon beim Happy-End (das - typisch Hollywood-Prüderie - natürlich nicht über Geknutsche hinausgeht) seinen Angebeteten im Grunde ebenfalls zum Outing »zwingt« (was selbst bei einer heterosexuellen Beziehungsanbahnung unglaublich viel Druck von außen schaffen würde), was für mich leider den Eindruck erweckt, man propagiere, ein schwules Leben müsse immer exakt so verlaufen, wie Love, Simon es (vermeintlich) »vorlebt«. Und das ist dann schon eine veritable Horrorvision.
Im Presseheft kondensiert man den Film auf die Formel »John Hughes meets John Green« (sorry, wem diese Namen nichts sagen, der muss es halt googlen), für mich wirkte das Ganze eher wie Dawson's Creek mit einem Schuss Glee. Nicht zuletzt, weil der Spielort Creekwoods heißt und Simon und Leah eine zehnjährige Vergangenheit von Sleepovers hatten (inklusive einem bequemen Fensterausstieg). Love, Simon hat einige gute Gags, aber überzeugt nicht als Ganzes. Nicht zuletzt fand ich auch die Nebenfiguren (Freunde sind in der Highschool das Allerwichtigste) nicht überzeugend ausgearbeitet. Da haben mich andere Highschool-Komödien, wo die Schwulen-Rollen an die Sidekicks gingen (etwa Mean Girls oder Easy A) weitaus eher überzeugt. Ich warte jetzt auf den ersten Film eines großen Hollywood-Studios bla bla bla, der dann auch wirklich gelungen ist!
 |
Ocean's Eight
(Gary Ross)
Alternativtitel: Ocean's 8, Buch: Gary Ross, Olivia Milch, Kamera: Eigil Bryld, Schnitt: Juliette Welfling, Musik: Daniel Pemberton, Kostüme: Sarah Edwards, Production Design: Alex DiGerlando, Supervising Art Director; Chris Shriver, Set Decoration: Rena DeAngelomit Sandra Bullock (Deborah "Debbie" Ocean), Cate Blanchett (Lou), Helena Bonham Carter (Rose Weil), Anne Hathaway (Daphne Kluger), Rihanna (Nine Ball), Sarah Paulsen (Tammy), Awkwafina (Constance), Mindy Kaling (Amita), James Cordin (John Frazier), Richard Armitage (Claude Becker), Elliot Gould (Reuben), Michael Gandolfini, Conor Donovan (Bus Boys), Shaobo Qin (Yen), Dakota Fanning (Penelope Stern), Griffin Dunne (Parole Board Officer), Heidi Klum, Katie Holmes, Zac Posen, Tommy Hilfiger, Common, Jaime King, Olivia Munn, Kim Kardashian u.v.a. (as Themselves), 110 Min., Kinostart: 21. Juni 2018
Im Nachhinein betrachtet hätten einen die beiden unambitioniert bis peinlichen Plakatmotive bereits vorwarnen müssen.
Nach Steven Soderberghs Star-Remake (George Clooney, Matt Damon etc.) eines vergleichbar starbesetzten (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis jr., Angie Dickinson) Heist-Movie von 1960 (Ocean's Eleven, dt. Titel: Frankie und seine Spießgesellen) folgten wegen des großen Erfolgs zwei Sequels, die sich jeweils nicht nur in der Anzahl der beteiligten Kriminellen (Ocean's Twelve, Ocean's 13), sondern auch sonstwie zu übertreffen suchten, und nun folgte à la Ghostbusters die Frauenversion, bei der der Titel Ocean's 8 schon nahelegte, dass man bei vergleichbarem Erfolg dann mit 9 und 10 die »Titellücke« schließen könne.
Debbie Ocean (Sandra Bullock), die gerade nach längerem Gefängnisaufenthalt entlassene Schwester von Danny Ocean (Clooney, diverse Male im Film angesprochen und einmal auf einem Bild zu sehen), hatte ihre staatlich unterstützte Zeit zum Nachdenken über einen großen Coup benutzt und sucht, kaum auf freiem Fuß, ihr weibliches Team aus Spezialisten zusammen. Cate Blanchett schlüpft in die Matt-Damon-Rolle der besten Freundin / Co-Workerin, ansonsten sind die Hauptfiguren unterschiedlich berühmt und mit auffälligem Diversitäts-Focus gewählt.
Regisseur Gary Ross (Pleasantville, Seabiscuit, The Hunger Games) setzt ganz auf den Wiedererkennungswert (Luxus-Setting, Schnitt-Kinkerlitzchen, groovige Musik) und seine Stars, laut imdb soll das Budget immerhin 70 Mio. Dollar verschlungen haben, doch offenbar hat niemand die Verantwortlichen darüber informiert, dass so ein Heist Movie (insbesondere innerhalb dieser speziellen Serie) sich durch unerwartete Wendungen, Überraschungen und knifflige Komplikationen dreht, bei denen die Diebstahlexperten improvisieren müssen. In Ocean's 8 läuft alles viel zu glatt (man hat sogar nebenbei Zeit, sich die Fußnägel zu lackieren) und man hat scheinbar viel mehr Wert darauf gelegt, durch luxuriöse Kleider und unzählige Winzauftritte tatsächlicher Berühmtheiten aufzufallen.
Ich für meinen Fall würde Tommy Hilfiger nicht erkennen, wenn er mir über den Weg laufen würde, und bei Zac Posen fiel mir nur der Name auf, weil er auf dem Sitzplan der Metropolitan-Gala neben Katie Holmes stand. Dass es den Knaben tatsächlich zu geben scheint, habe ich erst dem Filmabspann entnommen - und bei zwei oder drei Auftritten im Film kam mir ein leicht verstecktes Gesicht auch bekannt vor, aber das Erkennspielchen fiel schon eher ärgerlich aus. Dakota Fannings »Rolle« als »Penelope Stern« erschöpft sich etwa (falls ich nichts übersehen habe) darin, dass sie mal auf einer Reklame auf einem Taxidach auftaucht.
Das war eigentlich auch schon alles, was man über diesen überflüssigen Film wissen muss. Wie lieb- und ambitionslos der Streifen heruntergekurbelt wurde, erkennt man neben den spannungsresistenten Ermittlungen eines Versicherungsexperten (James »Carpool Karaoke« Corden ist immerhin ganz putzig in der Rolle) vor allem in der Sequenz nach dem (Ist das jetzt schon ein Spoiler? Nee, oder?) geglückten Coup, als all die Figuren, über deren Hintergrund wir in den fast zwei Stunden reichlich wenig erfahren haben (»Nine Ball« Rihanna heißt etwa bürgerlich »Leslie« und hat eine kleine Schwester mit vergleichbarere krimineller Expertise), sich ihre sehnlichsten Wünsche erfüllen und Sandra Bullock (die im Film ihre ganz possierlichen, aber nicht fehlerfreien Deutschkenntnisse demonstriert) sich in der allerletzten Szene vors angebliche Grab ihres Bruders setzt, sich umständlich einen Martini kredenzt und zu ihm sagt »You would've loved it.« Von den Gala- und Bunte-AbonnentInnen abgesehen wenigstens einer.
Die einzige wirkliche Errungenschaft des Films liegt für mich darin, dass ich nun im Nachhinein die Regietätigkeit des hier nur als Produzenten auftretenden Soderberghs etwas mehr zu schätzen weiß.
 |
Halalelujah -
Iren sind menschlich!
(Conor McDermottroe)
Originaltitel: Halal Daddy, Buch: Conor McDermottrow, Mark O'Halloran, Kamera: Mel Griffith, Schnitt: Alexander Dittner, Constantin von Seld, Musik: Matthias Weber, Kostüme: Kerry Gooding, Szenenbild: Conor Dennison, mit Nikesh Patel (Ragdan Aziz), Colm Meaney (Martin Logan), Art Malik (Amir Aziz), Sarah Bolger (Maeve Logan), David Kross (Jasper), Deirdre O'Kane (Doreen Murphy), Paul Tylak (Jamal Aziz), Stephen Cromwell (Derek), Jerry Iwu (Neville), 95 Min., Kinostart: 21. Juni 2018
Entfernen wir zunächst den Elefanten aus dem Raum: der deutsche Titel »Halalelujah - Iren sind menschlich!« (nur echt mit dem Ausrufungszeichen) ist an Idiotie kaum zu überbieten. Die Wortzusammenführung »Halalelujah« ist ein Zungenbrecher, der in seinem Begehren, »witzig« zu sein, komplett außer acht lässt, dass das so christlich anmutende Hallelujah tatsächlich etymologisch von »Halal« abstammt. Dass es im so bezeichneten Film kaum ums Christentum per se geht und nirgends ein Hallelujah ausgestoßen wird, kommt zu diesem Ärgernis noch dazu. Und das witzfrei umgeformte Sprichwort wurde offensichtlich nur dazu erfunden, weil deutsche Filmverleiher der irrigen Annahme sind, dass man das Publikum mit aller Macht auf bestimmte Zusammenhänge hinweisen muss. Vermeintlich gibt es einen großen Freundeskreis des irischen Kinos, der aber viele irische Filme schlichtweg deshalb verpasst, weil man versäumte, einen deutlichen Hinweis auf die Herkunft bereits im Filmtitel anzuzeigen. Deshalb kommt seit einiger Zeit auch in jedem deutschen Filmtitel von französischen Komödien eines der Demarkierungsworte »Madame«, »Monsieur« oder »Mademoiselle« vor. Um auf Schauspieler wie Omar Sy, Dany Boon oder Christian Clavier zu achten, die dann jeweils auf dem Filmplakat mit ihrem entsprechenden großen Kinoerfolg extra ausgewiesen werden, müsste man sich als geneigter Kinogänger ja viel zu ausführlich mit dem Film befassen. Um solchen Irrtümern zuvorzukommen, schreibt man halt irgendwo Iren oder irisch dazu. Und im schrecklichsten aller Fälle bastelt ein unterbeschäftigter Möchtegernkreativer noch einen sinnfreien Spruch daraus. So was wie »Irisch für Anfänger«, »Im Auftrag Irer Majestät« (ohne h!) oder ähnlicher Mist, über den ich gar nicht nachdenken will.
Der Schlenker rüber zur Komödie französischer Machart passt hier eigentlich ganz gut, weil vieles suggeriert, es könne sich bei Halal Daddy (auch kein Meisterwerk, aber kann man sich wenigstens merken) um eine politisch provokant-augenzwinkernde Multi-Kulti-Komödie handeln, die im besten Fall auch noch etwas vom Geist der irischen Independent-Komödie abbekommen hat. Weit gefehlt.
Ein etwas ziellos ins Erwachsenenleben startender junger Mann mit britisch-indischem Migrationshintergrund (Nikesh Patel als Ragdan) bekommt von seinem Vater (Art Malik) einen stillgelegten Schlachthof zum Geburtstag, den er in eine erfolgreiche Produktionsstätte von Fleisch nach muslimischen Regeln verwandeln soll. An seiner Seite: Colm Meaney als in vieler Hinsicht ahnungsloser Schlachthofexperte, der nebenbei auch noch der Vater von Ragdans Freundin ist. Die Konflikte sind vorprogrammiert, und wem das nicht reicht, der wird noch erleben müssen, dass die auserkorene Herzensfrau (Sarah Bolger als Maeve) sich auch noch über Gebühr mit ihrem (deutschen!) Exfreund (David Kross) beschäftigt, was neben den daddy issues auch noch Eifersuchtsdramen heraufbeschwört.

© Koch Films
Könnte ganz witzig werden (das Presseheft spricht von »fleischgewordener Völkerverständigung«), wenn das Drehbuch nicht so lange imaginierte Konflikte aneinanderreihen würde, bis man sich relativ ambitionslos darauf besinnt, dass bei einer echten Feelgood-Komödie am Schluss alle »gute Freunde« sein müssen - wozu man einfach mal den Großteil an Konflikten nahezu wieder vergisst und eine deus-ex-machina-Lösung herbeizitiert, die selbst bei einem Benjamin-Blümchen-Hörspiel als unangenehm naiv aufgefallen wäre.
Dass als Co-Autor hier Mark O'Halloran (Viva, Adam and Paul) engagiert wurde, ist angesichts des Ergebnisses und des mehrfach erkennbaren Talents O'Hallorans das traurigste von vielen traurigen Details.
Ich muss zugeben, dass ich dem Streifen wegen des Sympathie-Bonus für Colm Meaney und Sarah Bolger zunächst einiges habe durchgehen lassen, aber man kann seine Augen selbst bei besten Absichten nicht dauerhaft vor den tölpelhaften Vergehen der Filmhandlung verschließen.
Das Schlimmste ist hier nicht, dass man die irische Version einer französischen Multikulti-Komödie auf dem Reißbrett der rein einspielorientierten Filmbranche ersann. Nein, der Umstand der deutschen Co-Produktion zwingt das zombiehafte Gammelfleisch noch tiefer in den Morast. Man kann sich fast die Produktionssitzungen vorstellen, bei denen den Autoren immer wieder »weniger Ambitionen« abverlangt wurden und stattdessen mehr lahme Scherze ins Skript eingebaut wurden (z.B. der bemüht »integrative« Bauchtanz zu Boney M.s Rivers of Babylon - trotz bewusster Ironie so altbacken und typisch deutsch wie nur irgendwas.
Komplett austreiben konnte man das kreative Element nicht, aber der Patient ist am Ende zweifelsfrei klinisch tot.
Demnächst in Cinemania (Langzeitplanung, evtl. auf mehrere Ausgaben verteilt):
Startaktuelle Rezensionen zu Aus nächster Distanz (Eran Riklis), Grenzenlos (Wim Wenders), Safari - Match me if you can (Rudi Gaul), Zentralflughafen THF (Karim Aïnouz) und anderen, noch zu sichtenden Filmen.
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 186:
186: