
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
|
21. Dezember 2016 |
Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||||||
|
|
|
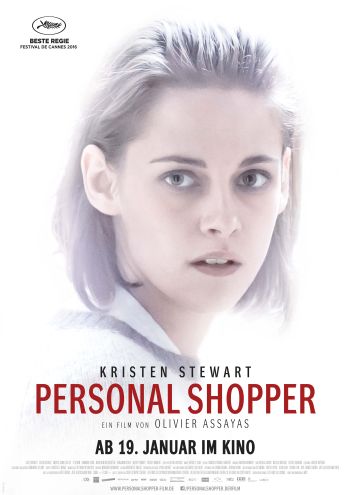 |
Personal Shopper
(Olivier Assayas)
Frankreich / Deutschland 2016, Buch: Olivier Assayas, Kamera: Yorick Le Saux, Schnitt: Marion Monnier, Kostüme: Jürgen Doering, Production Design: François-Renaud Labarthe, Set Decoration: Martin Kurel, mit Kristen Stewart (Maureen Cartwright), Lars Eidinger (Ingo), Sigrid Bouaziz (Lara), Anders Danielsen Lie (Erwin), Nora von Waldstätten (Kyra), Ty Olwin (Gary), Hammou Graïa (Police Officer), Benjamin Biolay (Victor Hugo), Audrey Bonnet (Cassandre), Pascal Rambert (Jérôme), 105 Min., Kinostart: 19. Januar 2016
Vorweg: Olivier Assayas bleibt sich treu. Wer Clouds of Sils Maria mochte, wird in seinem neuen Film einiges wiedererkennen. Nicht nur Darsteller wie Kristen Stewart, Lars Eidinger und Nora von Waldstätten (die Co-Produktion mit Deutschland scheint dem Regisseur gefallen zu haben), sondern auch Themen wie die Einbindung von »found footage« in die Handlung. Diesmal geht es sogar so weit, dass das veränderte Medienverhalten in der heutigen Zeit den Film stilistisch deutlich prägt. Wo man früher Telefonate als »Drehbuch-Abkürzungen« benutzte, um die Handlung voranzutreiben, wirkt es in Personal Shopper für gut 20 Minuten so, als sähe man fast unablässig auf das Display eines Smartphones, was ein eher »gewöhnungsbedürftiges« Erlebnis auf der Kinoleinwand ist und einige Kritiker verstimmte. Man darf aber dabei nicht aus den Augen verlieren, was Assayas in dieser Passage noch alles so »nebenbei« erzählt - und dadurch wird es teilweise auch fast meisterlich, auch wenn mein Bedarf an dieser Art von Kino vorerst gedeckt ist.
Ich hatte generell so meine Probleme mit dem Film. Das beginnt damit, dass ich Kristen Stewart nicht im gleichen Maße wie Assayas für eine begnadigte Darstellerin halte. Dann übt kostspielige Mode auf mich nicht so eine Faszination aus, und vor allem gibt es eine gewisse Art von Geistererscheinungen (und Filme um dieses Thema herum), die mich ein wenig langweilt.
Ein Kritikerkollege erklärte mir nach dem Film, dass es aber ja in diesem Film eher um eine metaphorische Ebene solcher »Geister« ginge, wie zumindest ihm schon sehr früh im Film klar wurde. Ich muss zugeben, mir wurde es selbst beim (übrigens sehr gelungenen und immens interessanten) Ende nicht gänzlich klar, inwiefern Assayas hier den Konventionen und Regeln dieser Art von Genre-Kinos entspricht oder sie doch eher konterkariert und ganz in den Nutzen dessen stellt, was er erzählen will.
Oder anders ausgedrückt: der Film polarisiert sehr - und das vermutlich auch mit voller Absicht. Und macht es einem dadurch sehr leicht, ihn nicht zu mögen. Aber ich habe mir Mühe gegeben, ihn zu mögen. Denn rein inszenatorisch läuft hier einiges ab, was wirklich kolossal ist.
Im Presseheft habe ich einen schönen Halbsatz gefunden, der erklärt (auch, wenn er nicht die Ansichten Assayas' teilen muss, sondern vielleicht nur eine Marketingstrategie verfolgt, die auch diametral zum Film ausgelegt sein könnte), warum der Film bei mir eigentlich von vornherein schlechte Karten hat: »[Maureen ist] inmitten der oberflächlichen Flüchtigkeiten einer modernen Welt voller Glamour auf der Suche nach Spiritualität und Wahrheit«.
Hier wird also eine Dichotomie eröffnet, die nicht nur in meinen Augen nicht wirklich funktioniert. In dieser Auslegung interessieren mich die beiden vermeintlichen »Gegensätze« kaum - und so kann daraus natürlich auch keine Spannung entstehen.
Ein paar Sätze zur Handlung: Die junge Amerikanerin Maureen (Kristen Stewart) arbeitet in Paris als »Personal Shopper« für eine lange Zeit mysteriös erscheinende Prominente. Mit ungepflegt wirkenden Haaren ist sie auf ihrem Motorrad unterwegs und bringt teure Kleidertaschen voller exklusiver Modelle von A nach B. Hier hat man schon mal einen inhärenten Widerspruch zwischen »mir egal, wie ich rumlaufe« und »maßgeschneiderten Luxus«, wie er für viele Zuschauer interessant sein könnte (wird im Verlauf der Story auch ausgebaut).
Die eigentliche Geschichte des Films dreht sich aber um Maureens verstorbenen Zwillingsbruder Lewis, mit dem sie, unterstützt durch dessen Freundin, Kontakt aufnehmen will. Und so lernt man Maureen kennen, wie sie in einem leeren Haus mit knartschenden Böden und knarrenden Türen im Dunkeln den Geräuschen des Hauses lauscht - und vielleicht eines Geistes, der nicht zwangsläufig der ihres Bruders sein muss.
Wenn Assayas hier mit (durchaus innovativen) Geisterbildern spielt, kann man natürlich auch einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, wie viel von dem, was wir als Zuschauer ganz klar sehen können, vielleicht doch nur eingebildet ist. Doch dieser Herangehensweihe entgegen wirkt der Umstand, dass Personal Shopper sich durchaus dem Genre des Mystery-Thrillers (in der Assayas-Auslegung) verschreibt, den nebenbei bekommt Maureen jetzt auch noch geheimnisvolle und bedrohliche Textnachrichten, bei denen der Film lange Zeit offen lässt, ob man es jetzt mit einer Variante der besonders in Japan und Korea beliebten Technologie-Geister zu tun hat (Ringu, One missed call etc.) oder ob die Bedrohung (unabhängig von dem, was man sonst noch so zu sehen bekommt) eher »handfest« ist.
Ich kann nur für mich selbst sprechen: die Spannung hielt sich für mich in Grenzen, und auf der metaphorischen Ebene habe ich mich auch nicht komplett auf den Film eingelassen. Und am Schluss war ich dann irgendwie doch etwas ratlos.
Aber es gibt mindestens eine Szene, für die sich der Kinobesuch definitiv lohnt, und die gerade dadurch umso besser funktioniert, weil man den ganzen Hokuspokus vorher eine gute Stunde lang durchlitten hat. Inszenierung und Montage implizieren, dass man dem Weg einer unsichtbaren Präsenz folgt. Lifttüren etc. öffnen sich ohne erkennbare Erklärung.
Und dann sieht man die selbe Einstellungsfolge nochmal - und für den Betrachter entsteht hier interpretativ etwas, was mich an das Phänomen der Verdichtung in der Freudschen Traumdeutung erinnerte (übrigens eine Herangehensweise, die erstaunlich gut zum Film passt). Und sowohl dieser - ja, man muss es eigentlich »Schock« nennen - als auch eine spätere Szene, die noch mal der zuvor abgelaufenen Handlung den Teppich unter den Füßen wegreißt, machen aus dem Film irgendwie tatsächlich eine Art Meisterwerk - wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und sich nicht bereits entschieden hat, mit diesem »Blödsinn« (Stichwort »Ektokotze«) nichts anfangen zu können.
Oder anders ausgedrückt: Der Film hat das Potential, einen zu verzaubern, wird aber einen weitaus größeren Prozentsatz des Publikums vergrätzen. Ich gehöre irgendwie eher zur letzteren Gruppe, erkenne aber, dass dieser cineastische Poltergeist es verdient hat, sich eingehend mit ihm zu befassen.
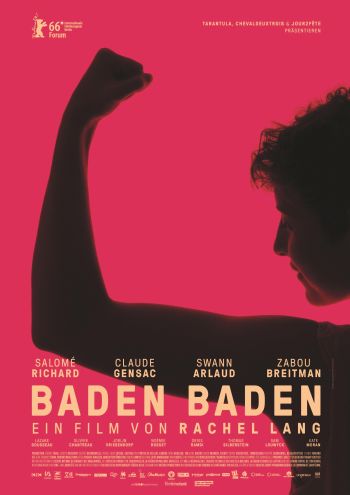 |
Baden Baden
(Rachel Lang)
Belgien / Frankreich 2016, Buch: Rachel Lang, Kamera: Fiona Braillon, Schnitt: Sophie Vercruysse, Kostüme: Delphine Laloy, Production Design: Jean-François Sturm, Set Decoration: Elwir Poli, mit Salomé Richard (Ana), Claude Gensac (Oma), Lazare Gousseau (Grégoire), Swann Arlaud (Simon), Olivier Chantreau (Boris), Jorijn Vriesendorp (Mira), Noémie Rosset (Meriem), Zabou Breitman (Anas Mutter), Thomas Silberstein (Samson), Kris Portier de Bellair (Boris' Mutter), Régis Lang (Anas Vater), Arnaud Lang, Patrick Lang (Anas Onkel), Kate Moran (Lois), Mathieu Mortelmans (Produktionsassistent), Sam Louwyck (Andrew), Driss Ramdi (Amar), Charlotte Marchal (Nachbarin der Oma), 96 Min., Kinostart: 29. Dezember 2016
Es gibt viele Filme, die mit gut durchdachten ersten Szenen beginnen und dann immer mehr auseinanderfallen. Ebenso, wie es auch Filme gibt, die ganz auf ihr Ende hin inszeniert sind, bei denen man das aber merkt und im Nachhinein die Stellen entdecken kann, wo man es nicht so gut geschafft hat, das Ende vorzubereiten.
Im günstigsten Fall sollte ein Film natürlich von Anfang bis Ende durchdacht sein. Aber im Fall von Baden Baden ist es wichtig, dass der Zuschauer nie das Gefühl bekommt, die »Story« sei zu durchdacht - weil die Hauptfigur Ana (Salomé Richard) superdeutlich ihr Leben nicht im Griff hat. Und was würde es da für einen Sinn geben, wenn die Inszenierung sich komplementär zur Protagonistin verhält.
Dennoch beginnt der Film mit einer vierminütigen Szene, die zwar nicht unbedingt den hochtrabenden Begriff »Plansequenz« verdient, aber dennoch davon zeugt, dass hier einiges gut durchdacht wurde, was im weiteren Verlauf des Films eher - schönes englisches Wort - haphazard, also wahllos wirkt.
Ana arbeitet als Fahrerin bei einer Filmproduktion und man sieht sie am Steuer ihres Fahrzeugs, während man die »Passagierin« nur auf dem Rücksitz telefonieren hört. Die Kamera ist ganz auf Ana fixiert, die offenbar Probleme hat, den Drehort zu finden. Als sie dann ankommt, staucht sie ein Produktionsassistent gehörig zusammen. Sie ist 45 Minuten zu spät, was für die Produktion bedeutet, dass 40 Leute eine Stunde länger arbeiten müssen. Man merkt, dass Ana diesem Druck nicht standhalten kann (früher oder später kommen auch die Tränen), während ihr Boss immer mehr durchdreht (Professionalität ist auch etwas anderes) und ihr dann als »pädagogischer Maßnahme« aufbrummt, »3-5mal« den offenbar immer gleichen Weg hin- und zurückzufahren. Die zweite Einstellung des Films zeigt fließendes Wasser, dann sieht man Ana verheult in einer Autowaschanlage und die Titeleinblendung suggeriert, dass Wasser eine große Rolle im Film spielen wird. Das würde ich so aber nicht unterschreiben, eher geht es um den Fluss des Lebens (panta rhei - alles fließt), und im weitesten Sinne darum, ob man sich diesem Strom unterordnet, ihm entgegenschwimmt - oder lieber baden geht und sich treiben lässt.
Der Filmtitel Baden Baden fordert übrigens auch nicht vom französisch-sprechenden Publikum, diese Worte zu übersetzen, sondern bezieht sich darauf, dass Ana wohl von Straßburg aus zu einem Baumarkt (Bauhaus) in der Nähe von Baden Baden fährt, um für ihre Großmutter eine neue Dusche zu bauen. Wobei das bereits eine Handlungskonstruktion ist, die man nicht direkt aus dem Film entnehmen kann (zumindest ich nicht), sondern die ich mir im Nachhinein über Recherche erschlossen habe. Mir war jedenfalls nicht bewusst, dass beide Orte sich in Grenznähe befinden.
Zurück zum Film. Vieles findet hier eher implizit statt (weitaus unklarer als etwa in Ce sentiment de l'été) und man muss schon recht aufmerksam sein, um die Männer in Anas Leben korrekt zuzuordnen. Ihr Beziehungsstatus ist ähnlich verschwommen wie die kleinen Jobs, die sie zwischendurch anreißt oder auch nur in Betracht zieht. Am absurdesten wirkt ihre »Beziehung« mit einem eingeschränkt attraktiven Mitarbeiter des erwähnten Baumarkts, der dort extra für die französischen Kunden angestellt wurde, aber offensichtlich kaum einen Überblick über die Produkte hat, die er diesen anbietet. Nach einem gemeinsamen Bierchen im Musterbad motiviert Ana diesen Grégoire (Lazare Gousseau) dazu, ihr beim Umbau des Badezimmers zu helfen. Es wird deutlich, dass er auch davon kaum Ahnung hat und sich eher etwas anderes von Ana erhofft. Ich will Anas nebenbei ablaufenden Techtelmechtel (unter anderem auch eines, das - Thema!?! - in einer Dusche stattfindet) und ihre Beziehung zum Bruder und der Großmutter (zentral!) nicht alle detailliert auseinanderklamüsern, meine Lieblingsszene des Films spielt in einer Karaoke-Bar, wo sie gemeinsam mit Grégoire ein Lied singt, während eine ebenfalls sexuell an ihr interessierte Schauspielerin (?), die sie vom Filmjob kennt, um sie herumscharwenzelt, und Ana zumindest mal ansatzweise gezwungen wird, Partei zu ergreifen (sehr gefällig hier auch der Einsatz des alten Samantha-Fox-Reißers Touch Me - manchmal wird Subtilität auch überschätzt!).
Als Donaldist befasst man sich gerne mit dem Phänomen des Scheiterns, und aus diesem Grund gefällt mir auch dieser Film. »Es wird übel ausgehen«, »Erbärmlicher Pfuschjob« - diese Kommentare beziehen sich zwar vordergründig auf den Umbau der Dusche, passen aber auch zu Anas Lebenseinstellung und dem Film an sich. Man merkt (in allen drei Instanzen), dass an allen Ecken das Geld, oft auch die Expertise fehlt, aber man versucht sich zu helfen, »das Beste draus zu machen«.
Filmisch bedeutet das, dass man alles irgendwie mit in den Film aufnimmt, was visuell interessant erscheint. Oder auch mal aus anderen Gründen faszinierend wirken könnte (das Gespräch über die verplante Betäubung). Das Kunststück der Regisseurin ist hierbei aber, dass sie daraus (oft hat man auch das Gefühl, dass das Drehbuch davon mitbestimmt wurde, welcher der Nebendarsteller gerade zur Verfügung stand) irgendwie trotzdem einen erstaunlich stimmigen Film bastelt, der eine Art Lebensgefühl sehr gut umsetzt (was bei mir in Ce sentiment de l'été noch besser klappte, in Fidelio - L'odysée d'Alice indes kaum).
Und gerade bei so Filmen, die beim Großteil des Publikums eigentlich keine Chance habe, entwickle ich manchmal (längst nicht immer!) irgendwelche Beschützerinstinkte und handle nach dem Prinzip in dubio pro reo. Bei Baden Baden hatte ich ein wenig das Gefühl, dass Ana meine Tochter sein könnte. Sie vermurkst so ziemlich vieles im Leben, zeigt auch kaum einen Lerneffekt - aber man wünscht ihr trotzdem, dass sie die Kurve kriegt. Und das schließt hier auch irgendwie den Film mit ein und seine junge Regisseurin, die übrigens auch aus Straßburg kommt und hier vermutlich auch irgendwelche autobiographischen Erlebnisse verarbeitet. Darauf muss man sich gegebenenfalls einlassen. Und in meinem Fall hat die erste Einstellung stark dazu beigetragen, dass ich dem Film trotz seiner Irrungen und Wirrungen diese Chance gegeben habe - und es auch nicht so sehr bereut habe.
Auf jeden Fall eine Filmemacherin, von der man mehr sehen will.
In Deutschland hat der Film übrigens den so idiotischen wie irreführenden Zusatztitel »Glück aus dem Baumarkt?«, der auf mich so wirkt, als würde man einen halbverhungert und traumatisiert in einer Mülltonne gefundenen kleinen Hund als »pflegeleicht und verschmust« in einer Anzeige anbieten. Hauptsache an den Mann (oder die Frau) bringen! Man kann das schlecht generalisieren, aber wenn der Film schon ein Publikum finden soll, das mit ihm etwas anfangen kann, dann vermutlich nicht unbedingt unter den Leuten, die darin (größtenteils vergeblich) nach dem »Glück« aus dem Titel fahnden.
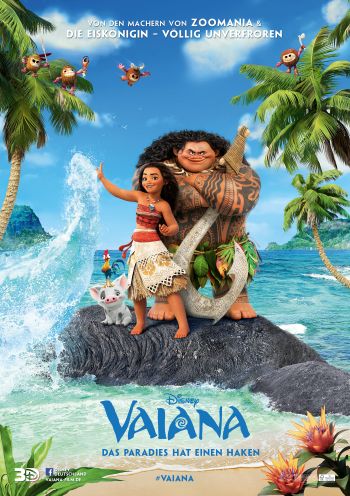 |
Vaiana
(Ron Clements & John Musker)
Originaltitel: Moana, USA 2016, Co-Regie: Don Hall, Chris Williams, Buch: Jared Bush, Schnitt: Jeff Draheim, Musik: Opetaia Foa'i, Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda, mit den Originalstimmen von Auli'i Cravalho (Moana / Vaiana), Dwayne Johnson (Maui), Nicole Scherzinger (Sina), Temuera Morrison (Chief Tui), Chris Jackson (Chief Tui Gesang), Rachel House (Gramma Tala), Jemaine Clement (Tamatoa), Alan Tudyk (Hei Hei the Rooster), 113 Min., Kinostart: 22. Dezember 2016
Ich sehe Filme bevorzugt in der Originalfassung, aber weil der Name »Moana« in Europa irgendwo als Handcreme oder so geschützt ist, musste Disney mal wieder den Titel hier ändern, und weil der gleichlautend mit dem Namen der Hauptfigur ist, heißt sie jetzt hierzulande Vaiana - und auch in der englischen Sprachfassung, die hier gezeigt wird, hört man niemals den (auf mich ohnehin seltsam wirkenden) Namen »Moana«. Beide Namen bedeuten auf polynesisch irgendwas, aber da man im Film fast durchgehend Englisch spricht und singt, habe ich das jetzt nicht detailliert recherchiert.
Disney hat ja seit einigen Jahren die Tendenz, vom christlich-kaukasisch-heterozentrischen Programm früherer Zeiten zunehmend abzuweichen, weil es politisch korrekter ist (wobei man es sich aber nie mit dem großen Publikum dafür verscherzen würde und beispielsweise sofort einen Rückzieher macht, wenn sich irgendwer von der implizierten sexuellen Orientierung von Elsa in Frozen auf den Schlips getreten fühlt). Und so hat man bei The Princess and the Frog ganz stolz verkündet, auch mal eine dunkelhäutige Prinzessin in den »Stall« aufzunehmen und scheint jetzt nach und nach alle Minderheiten (oder Abweichungen von der US-amerikanischen Norm) nach und nach abzuklappern, siehe etwa Pocahontas oder Mulan. Auch die starken Frauenfiguren, also quasi Prinzessinnen, die auch etwas besseres zu tun haben, als nach ihrem Prince Charming zu fahnden, machen sich immer breiter bei Disney (ich unterscheide zwar deutlich zwischen Disney und Pixar, aber Brave schlägt natürlich exakt in die selbe Kerbe).
Bei Vaiana hat man sich außerdem in der Handlung stark auf die folkloristisch-traditionell-mythologischen Wurzeln der Polynesier gestützt (wirkt auch cleverer als beispielsweise Rumpelstilzchen dahin umzusiedeln) und erzählt jetzt die Geschichte einer Häuptlingstochter, die als Navigatorin das Geschick ihres Stammes leiten will, weil der Vater nach einer traumatischen Erfahrung gern auf Nummer sicher geht und quasi ignoriert, dass das Inselleben zunehmend schwieriger wird und man die Bevölkerung auf Dauer nicht mehr ohne Risiken ernähren kann. Hört sich soweit fast realpolitisch an, wird aber vermengt mit Gottheiten, vermeintlichen Superkräften und einem von Dwayne »The Rock« Johnson gesprochenen Halbgott namens Maui, der - mit einer fast kompletten Aussparung irgendwelcher romantischen oder sexuellen Anziehung - Vaiana zur Seite gestellt wird. Aus dieser Paarkonstellation macht der Film noch am meisten, oft wirkt das Ganze wie eine Screwball-Komödie ohne das obligatorische Liebesthema. Doch die beiden fetzen sich auch gern über selbstreferentielle Details (»I'm not a princess, I'm the daughter of the chief!« - »If you wear a dress and have an animal sidekick, you're a princess!«) oder machen popkulturelle Scherze (»When you use a bird to write with ... it's called tweeting.«) Das sind aber nicht die einzigen Details, die in diesem Film irgendwie nicht funktionieren.
Ich kann nicht für jedermann sprechen, aber ich habe im Film unzählige Disney-Versatzstücke wiedererkannt, aber der übliche Zauber wollte sich nicht annähernd einstellen. Die Songs haben mich nicht angesprochen (statt hübscher Wortspiele klang es hier oft so, als würden die Song einfach ohne besonderen Bezug zu den Figuren die oft unnötig komplizierte Geschichte verbal miterzählen), die Hauptfigur wirkte auf mich nicht wie eine zwar idealisierte, aber fast reale Person, wie ich es bei Rapunzel, Belle oder den Frozen-Schwestern erlebte. Und von den Nebenfiguren war die Großmutter noch am überzeugendsten - auch, wenn ihre Rolle für die Handlung sehr aufgesetzt wirkte.
Aus gleich vier möglichen Sidekicks, die im Film auftauchen, entscheidet man sich ausgerechnet für einen reichlich idiotischen Hahn, der Laute wie Donald Duck von sich gibt (Schildkröte, Schwein und das Wasser als Quasi-Weiterführung des Teppichs aus Aladdin wären die anderen drei gewesen). Als Bösewicht hat man auch bessere Pausenfüller eingesetzt, wobei Jemaine Clement als Tamatoa wenigstens noch einen ganz hübschen Song bekommt - der aber irgendwie kaum zum Rest des Films in einer Beziehung steht. Fast noch schlimmer sind die vermeintlich possierlichen Kokosnuss-Piraten, auf die sich auch die Marketingstrategie des Films zu stützen scheint, die aber mit ihrem Kurzauftritt als Disney-Version der Meute aus Mad Max: Fury Road ebenfalls fast nichts mit der Geschichte zu tun haben.
Das ist in meinen Augen kein Disney-Film mit der inhärenten (auch Story-)Qualität, die man über Jahrzehnte aufgebaut hat (und unter John Lasseter hat man ja keine schlechte Phase im Animations-Œuvre des Konzerns), sondern wirkt auf mich wie diese Sparwitz-Filme der zumeist qualitativ weit zurückbleibenden Konkurrenz, die sich mit Ice Age und dergleichen von Sequel zu Sequel hangelt, bis noch das letzte rausgelutscht ist aus einem Franchise - man eigentlich aber von Anfang an kaum etwas zu erzählen hatte.
Vielleicht haben auch zu viele am Drehbuch herumgedoktert oder man war irgendwie unter Zeitdruck, aber es passt einfach hinten und vorne vieles nicht. Muss man heute unbedingt Pipi-Kaka-Witze einbauen, als gäbe es nichts anderes, worüber man lachen kann? Und die Frage ist ja auch nicht, ob die »Höhle der Monster«, die man zwischendurch betritt, für kindliche Zuschauer geeignet ist - auch hier ist eine ganze Sequenz (abgesehen von der Vorbereitung auf den Endgegner) komplett überflüssig. Beim klassischen Disneyfilm, aber bis hinein in die Pixar-Zeit kennt man doch aus den Bonusmaterialien, wie in Writing-Sessions am Storyboard gefeilt wird, bis nach und nach alles stimmig wird. In diesem Fall wirkt der Film wie ein bunter Flickenteppich, der zwar hübsche Passagen und Einfälle hat, aber einfach als Ganzes nicht einmal ansatzweise funktioniert.
Da gibt es eine in drei Minuten absolvierte Psychotherapie, die quasi der Kern des ganzen Films ist - aber keiner gibt sich die Mühe, dass im Film zu verankern. Und wenn die Heldin am Schluss statt eines Steins eine rosa (!) Muschel ablegt, ist auch die überdeutliche Symbolik des Feminismusdingens eher ein schlecht erzählter Herrenwitz.
Das Beste an Vaiana ist diesmal leider der Vorfilm Inner Workings, der zwar auch nur auf einer eher simplen Idee beruht und die visuell geringfügig ausschmückt - aber das ist wenigstens ein Film, der von vorne bis hinten schlüssig wirkt und aus seiner Laufzeit herausholt, was man daraus machen kann, während Vaiana zu allem Übel auch noch fast zwei Stunden geht, wobei man das Gefühl hat, dass mit vernüftigem Streamlining ohne komplett neue Ideen ein ganz okayer 72-Minuten-Film draus hätte werden können. Mein Verdacht aber ist, dass man auch bei Disney merkte, dass hier irgendwas fehlt - und dann eben die hübschen und witzigen kleinen Episoden dazugebastelt hat. Und hoffte, dass das Publikum sich für die winzigen Details begeistern kann.
 |
Die Taschendiebin
(Park Chan-wook)
Südkorea 2016, Originaltitel: Ah-ga-ssi, Int. Titel: The Handmaiden, Buch: Park Chan-wook, Chung Seo-kyung, Lit. Vorlage: Sarah Waters, Kamera: Chung Chung-hoon, Schnitt: Kim Jae-bum, Kim Sang-beom, Musik: Cho Young-wuk, Kostüme: Cho Sang-kyung, Production Design: Ryu Seong-hee, mit Kim Min-hee (Lady Hideko), Kim Tae-ri (Sookee), Ha Jung-woo (Graf Fujiwara), Cho Jin-woong (Kouzuki), Kim Hae-sook (Frau Sasaki), Moon So-ri (Hidekos Tante), 144 Min., Kinostart: 5. Januar 2017
Ich bin bekannt dafür, öfters mal die Literaturvorlagen zu Filmen zu lesen. Am besten macht man das so: Man schnappt sich das Buch, versucht bis zur Filmsichtung die Hälfte zu lesen, schaut dann den Film und liest zuende.
In diesem Fall war es aber so, dass ich erst gegen Ende des Films begriff, dass es eine Vorlage gibt, die aus Wales stammt und im viktorianischen England spielt - wo der Film im Korea der 1930er angesiedelt ist. Dadurch wurde ich neugierig, besorgte mir das Buch... und schaute mir den Film sogar noch ein zweites Mal an (wenn diesmal auch leider in der Synchronfassung, die jede Unterscheidung zwischen koreanischen und japanischen Dialogpassagen übrigens verschwinden lässt). Zu dem Zeitpunkt war ich etwa auf Seite 330 (von 550) des Romans.
Erst nach der zweiten Sichtung wurde mir klar, dass es ja im Abspann heißt, dass der Film von Sarah Waters' Fingersmith inspiriert ist. Das heißt in diesem Fall: man übernahm von drei Teilen, die im Buch klar unterscheidbare Erzählfiguren haben, ungefähr die ersten anderthalb Teile, bastelt ein wenig an dem unterschiedlichen Spielort und schreibt den dritten Teil eigentlich komplett um.
Veränderungen können auch Verbesserungen sein. Stanley Kubricks The Shining unterscheidet sich deutlich von Stephen Kings Roman - ist aber um Klassen besser als die »werkgetreue« Fernseh-Zweiteiler-Version. Atom Egoyans The Sweet Hereafter schmeißt die klar visuellste Passage aus Russell Banks' Roman raus und ersetzt sie mit den »literarischen« Hinweisen auf den Rattenfänger im Hameln - ein Element, das man vergeblich im Roman sucht.
Im Fall von Park Chan-wook ist es aber so, dass er für ihn typische Handlungselemente (Strangulation, Inzest, Kraken, Freeze Frame) einbaut und dabei zu übersehen scheint, dass seine Version zwar einige gelungene Passagen hat (der Weg zur Schiffsreise), aber nicht ansatzweise so gut durchdacht ist wie der Roman.
Zwischendurch die angerissene Inhaltsangabe der Teile, die in Buch und Film gleich sind: Eine junge Taschendiebin von niedrigem Stand soll einem vermeintlichen »Gentleman« (im Film sogar ein falscher Graf) dabei helfen, eine zukünftige Erbin zu heiraten, in dem sie den Posten ihrer Dienstmagd übernimmt. Trotz der Lügen und Intrigen (die feine Dame hat auch so ihre eigenen Pläne, denn sie will unbedingt weg von ihrem Onkel, der sie zur Vorleserin einer seltsamen Porno-Bibliothek ausbildete) entsteht zwischen den jungen Frauen eine intime Nähe und mehr...
Das Problem des Films ist nicht, dass er weitaus reißerischer ausfällt und sich nicht jeder mit dem seltsamen Slapstickhumor anfreunden wird (in der dt. Synchro noch weitaus schlimmer, weil das Kreischen und Stottern dort noch deutlicher herauskommt), sondern es halt eine Sache ist, wenn eine Romanautorin, die längere Zeit zu viktorianischer Pornographie recherchierte, in ihren Werken gern lesbische Lovestorys erzählt (in der Literatur kann man wunderschön mit zweideutigen Wortspielen arbeiten - der letzte Absatz des Romans ist hier an subtil-schwülstiger Poesie nur schwer zu überbieten), die zu dieser Zeit spielen und so ausgewalzt wirken wie zu Dickens' Zeiten. Und eine gänzlich andere Sache, wenn ein Kerl daraus eine Edel-Trash-Streifen macht, bei dem einerseits (übrigens japanische!) Pornographie verdammt wird, man aber die beiden Protagonistinnen wie in einem Softporno zur Schau stellt (die entsprechende Szene hat zwar auch was von weiblicher Solidarität und Befreiung, aber Park fehlt hier einfach neben der Perspektive die Subtilität, mit der man das umsetzen müsste). Das ist quasi die selbe Diskussion, die auch damals bei Blau ist eine warme Farbe (im Gegensatz zu den französischen Originaltiteln gibt es hier im Deutschen eine Titelübereinstimmung) vorherrschte. Nur, dass Sarah Waters mit der Situation erstaunlich locker umzugehen scheint.
Wo der Film einen Vorteil vorm Buch hat: hier ist alles eine ganze Ecke hübscher (manchmal sogar zu ästhetisiert). Ein CGI-Himmel wie bei Camerons Titanic, ein teilweise toller Soundtrack, man schwelgt im Production Design (wenn auch nicht so sehr wie bei Stoker) und es gibt durchaus Zuschauer, die von der Lovestory hingerissen sind.
 |
Passengers
(Morten Tyldum)
USA 2016, Buch: Jon Spaihts, Kamera: Rodrigo Prieto, Schnitt: Maryann Brandon, Musik: Thomas Newman, Kostüme: Jany Temime, Production Design: Guy Hendrix Dyas, Set Decoration: Gene Serdana, mit Chris Pratt (James »Jim« Preston), Jennifer Lawrence (Aurora Lane), Michael Sheen (Arthur), Laurence Fishburne (Gus Mancuso), Julee Cerda (Instructor Hologram), Andy Garcia (Captain Norris), Jon Spaihts (Voice of Autodoc), 116 Min., Kinostart: 5. Januar 2017
In manchen Kreisen von Hollywood wird Autor Jon Spaiths wohl als »next big thing« gehandelt, aber ich muss sagen, die Drehbücher zu The Darkest Hour, Prometheus und Doctor Strange haben mich allesamt nicht eben überwältigt, und von Van Helsing und The Mummy erwarte ich mir auch nicht soo viel.
Sein Buch zu Passengers befand sich wohl auf der berühmten blacklist der vielversprechendsten unproduzierten Skripte, aber wenn die ursprüngliche Version und der endgültige Film sich sehr ähnlich sind, differenziert sich mein Geschmack schon stark von dem, was man in Hollywood als bemerkenswert und gut definiert.
Seit Gravity, Her oder Ex machina steht fest, dass man das »Männer-Genre« Science Fiction durchaus mit Romanzen oder Beziehungsgeschichten verbinden kann und so ein größeres Zielpublikum (Stichwort »date movie«) ansprechen kann. Da wirkt eine Besetzung mit vermeintlichen Superstars wie Jennifer Lawrence und Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic World, The Magnificent Seven) natürlich genial und der Trailer macht neugierig.
Inhaltskurzzusammenfassung der ca. ersten Hälfte des Films: Das Raumschiff Avalon ist mit 5000 Passagieren in Schlafkammern auf der Reise zur Kolonie »Homestead II«. Der Mechaniker Jim (Chris Pratt) erwacht durch eine Fehlfunktion von Pod 1498 zu früh, verwildert zunächst ähnlich wie Will Forte in der vergnüglichen Fernsehserie The Last Man on Earth, führt Gespräche mit dem Bar-Androiden Arthur (Michael Sheen) und hadert letztlich mit der Frage, ob er die attraktive Autorin Aurora (Jennifer Lawrence) aus Pod 1546 aufwecken soll, um nicht die bevorstehenden restlichen 89 Jahre der Reise allein zu verbringen ...
Im Gespräch mit Arthur kommt es so zur philosophisch-ethischen Grundsatzdiskussion. Soll man etwas tun, wenn es Dein Leben eine Million mal besser macht, aber es dennoch falsch ist? »Jim, these are not robot questions.«
Man soll ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber das größte Problem des Films war für mich, dass die Knutschi- und Schmusi-Kiste irgendwann klar im Vordergrund steht und man die actionreiche Sci-Fi-Handlung eher stiefmütterlich am Rande abhandelt. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Liebeshandlung mit dem größten gemeinsamen Teiler beim Publikum klar die Priorität hat gegenüber Wissenschaftlichkeit, Kohärenz oder Logik. Das soll nicht heißen, dass man dumme Fehler im Drehbuch findet. Man interessierte sich nur offensichtlich gar nicht dafür. Und was dabei rauskommt, ist quasi eine RomCom-Dramaturgie, die über eine Sci-Fi-Story gestülpt wird. Mit aufdringlicher Musik, Space Walk statt Strandspaziergang beim Sonnenuntergang und Händchenhalten im Raumanzug.
Dabei ist die erste Hälfte des Films durchaus noch interessant. Neben dem philosophischen Problem (für das man später eine blöde Ausrede findet) hat man viele kleine nette Gags (The Martian hat ja bewiesen, dass SF und Humor durchaus gut zusammenpassen). Und vor allem ein Production Design, in dem man schwelgen kann, weil es sich auf der Höhe der technologischen Möglichkeiten ganz an den Klassikern orientiert. Die Vorstellung der »location« erinnert an Ridley Scotts Alien, nur halt mit kürzeren Schnitten und gefälliger Musik. Und auch Stanley Kubrick stand Pate, sowohl mit 2001 - A Space Odyssey als auch mit The Shining. Schon durch den leuchtenden Tresen erinnern Jims Gespräche mit Arthur wie die Jack Torrances Rückfälle in den Alkoholismus, während er sich mit dem Barkeeper Lloyd unterhält. Und dem Qualitäts-Whiskey verschließt sich Jim auch nicht eben.

© 2016 Sony Pictures Releasing GmbH
Aber was macht man daraus? Anderthalb Gags mit »besorgten« Robotkellnern - und sobald Jim Aurora entdeckt, verwandelt er sich exakt so für die Frau, die noch im Schneewittchensarg liegt, wie sich unzählige Damen das von ihrem Traumpartner erwarten. Soviel Märchenquatsch wäre selbst in einer herkömmlichen RomCom unglaubwürdig.
Es kommt zwar auch im späteren Teil des Films noch zu einigen wirklich tollen Stellen (Arthurs »She is wonderful. Excellent choice« entspricht exakt dem US-Ideal eines Kellners, der unabhängig von der Bestellung immer »Excellent choice, sir.« sagt), aber das 3D-Brimborium der Spezialeffekte steht in keinerlei Relation zur komplett nebensächlich runtererzählten Technik-Krise und stattdessen bastelt der Mechaniker einen vermeintlich tollen Verlobungsring und bei der superfetten Lovestory muss man Angst haben, sich in seinen Raumhelm zu übergeben.
Und Morten Tyldum (Hodejegerne, The Imitation Game) wird das nächste Beispiel dafür, dass ein Aufbruch nach Hollywood aus manchem aufstrebenden Regietalent einen (gut verdienenden) Langweiler machen kann.
Nächstes Jahr in Cinemania 158:
Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (Theodore Melfi) und andere, noch zu sichtende Filme.
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 157:
157: