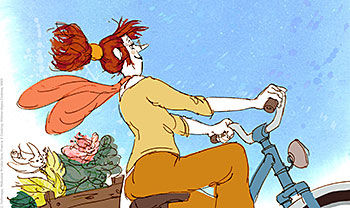| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
2. Februar 2014 | Thomas Vorwerk für satt.org | ||||||
  Alle Terminangaben sind sorgfältig abgetippt, aber ohne Gewähr. Die Filme werden immer unter dem Titel aufgeführt, unter dem man sie im offiziellen Berlinale-Katalog findet. |
|
 Bildmaterial © 1938 NIKKATSU Corporation, Tokio Vorführungen:
|
Oshidori utagassen
(Masahiro Makino, Retrospektive)
Intern. Titel: Singing Lovebirds, Japan 1939, Buch: Koji Edogawa, Kamera: Akira Mimura, Kazuo Miyagawa, Schnitt: Nobuo Miyamoto, Musik: Tokujiro Okubo, Masao Yoneyama, Set Decoration: Shigekichi Hasegawa, mit Chiezo Kataoka (Reisaburo Asai), Ryôsuke Kagawa (Soshichi Kagawaya), Takashi Shimura (Kyosai Shimura), Mitsuru Toyama (Man-emon Toyama), Kajô Onoe (Antiquitätenhändler), Hidemichi Ishikawa (Matsusuke Matsuda), Eizaburo Kusunoki (Sugiura), Ryutaro Chikamatsu (Hinokiyama), Matsunosuke Fukui (Takebayashi), Minoru Fujisaki (Yanagawa), Shirô Osaki (Tsubaki), Mitsuo Kobayashi (Sankichi), 69 Min.
Die diesjährige Retrospektive der Berlinale (traditionell noch vor der »Generation« jene Rubrik, in der man am ehesten beständig wirklich gute Filme findet) widmet sich »Aesthetics of Shadows – Lightning Styles 1915-1950«, wobei es vor allem um die USA (14 Filme), Japan (11 Filme) und Europa (7 Spielfilme und ein Kurzfilmprogramm) geht. Mehrfach vertretene Regisseure sind etwa John Ford, Howard Hawks, Friedrich Wilhelm Murnau, Hans Richter und Josef von Sternberg. Hierbei geht es u.a. darum, dass die Beleuchtungsstile des deutschen Expressionismus, die unterstützt durch Exildeutsche auch in Hollywood Fuß fassten (nein, diesmal kein Fokus auf die »schwarze Serie«, sondern stattdessen Kriegs- und »Straßenfilme«) auch in Japan ähnliche ästhetische Ausdrucksformen fanden. An Klassikern wie Ugetsu monogatari (strenggenommen 1953) oder Rashomon kann man das natürlich ohne Probleme festmachen, aber der japanische Teil der Retro stützt sich eher auf wenig bekannte Werke, bietet also Entdeckungen und Archivschätze.
Oshidori utagassen hat hier ein wenig das Problem, dass die Kopie, die zumindest der Presse vorgeführt wurde, eher nicht in einem Zustand war, um das Inszenierungsprinzip, das hier anhand künstlerisch und kontraststark gestalteter Papiersonnenschirme umgesetzt wurde, schlüssig zu betonen. Leider war es mir nicht vergönnt, mehr als einen der vier vorab gezeigten Filme zu sichten, aber da man Filme wie Entr'acte, Sunrise, Le quai des brumes, The Grapes of Wrath, Citizen Kane oder La belle et la bête (übrigens sehr schön passend zum Remake, das im Wettbewerb »außer Konkurrenz« läuft) bei ein wenig filmhistorischem Interesse über die Jahre hinweg schon mehrfach im Kino sah, wird es zumindest klar, worauf sich hier der Augenmerk richten soll.
Ungeachtet der etwas verwaschenen Kopie ist dieser spezielle Film aber ein echtes Fundstück, ein »Samurai Musical« (so auch einer der eher spekulativen Auslandstitel), in dem man eine eher simpel konturierte Liebesgeschichte durch allgegenwärtige und abwechslungsreiche Songs mit teilweise komplexen Sprachsituationen (leider in Sachen Lippensynchronität eher in Richtung Playback weisend) sehr aufwertet. Geradezu genialisch ist hierbei der durch die Liebe zu überwältigende Klassenunterschied, der anhand einer Obsession mit Antiquitäten thematisiert wird. Die suchtähnliche Ansammlung von eher schlichtem Tinnef war wohl maßgeblich daran beteiligt, dass der Vater der Heldin trotz seiner kunstvollen Schirmmalereien verarmte. Und nun findet sich die junge Frau nicht nur zwischen zwei wohlhabenden Kandidaten, die sie aus der Verschuldung retten könnten (wobei in einem Fall die »Rettung« schon ein übler Euphemismus wäre), über die Antiquitäten lassen sich auch Lebensweisheiten über die Liebe etc. einbringen, wobei man selbst eine simple Reisschale derart hingebungsvoll besingen kann, dass man als Zuschauer nicht mehr sicher ist, ob es sich um ein Heldenepos über die historischen Wurzeln der Töpferkunst handelt oder um eine Art Werbejingle. Die spielerische Verbindung von Hochkultur mit Trashelementen (wirklich großartig die leider nur kurz zelebrierte Kampfchoreographie, die einerseits brutale Genickbrüche andeutet, dabei aber immer »freundlich« bleibt) verblüfft hier sehr und macht den Film zu einem Juwel, an das man sich noch lange erinnern wird.
 |
Am Sonntag bist du tot
(John Michael McDonagh,
Irland / UK 2014, Originaltitel: Calvary, Buch: John Michael McDonagh, Kamera: Larry Smith, Schnitt: Chris Gill, Musik: Patrick Cassidy, mit Brendan Gleeson (Father James Lavelle), Kelly Reilly (Fiona), Chris O'Dowd (Jack Brennan), Orla O'Rourke (Veronica Brennan), Aiden Gillen (Dr. Frank Harte), M. Emmet Walsh (Gerald Ryan), Dylan Moran (Michael Fitzgerald), Isaach De Bankolé (Simon Asamoah), David Wilmot (Father Timothy Leary), Marie-Josée Croze (Teresa Robert), Doug Matthews (Prisoner), Domhnall Gleeson (Freddie Joyce), Gary Lydon (Gary Stanton), Killian Scott (Milo Herlihy), Owen Sharpe (Leo MacArthur, »Good Time Leo«), Mícheál g Lane (Michael O'Sullivan), Pat Shortt (Brendan Lynch), David McSavage (Bishop Montgomery), Una Caryll (Night Sister), Anabel Sweeney (Girl), Mark O'Halloran, 100 Min.
John Michael McDonagh, der mit The Guard den erfolgreichsten irischen Film aller Zeiten drehte, kehrt mit seinem neuen Film zurück zum Panorama. In der Hauptrolle erneut Brendan Gleeson, diesmal als katholischer Priester, dem gleich zu Beginn im Beichtstuhl ein Mitglied seiner Gemeinde offenbart, dass er einst als Kind von einem Priester misshandelt wurde, weshalb er seinen Beichtvater, der sich nichts zu schulden kommen ließ, am nächsten Sonntag töten will. Sozusagen »ein Unschuldiger für einen Unschuldigen«. Der Film beschreibt dann die darauffolgende Woche, während derer Father Lavelle unter anderem Besuch von seiner Tochter Fiona (Kelly Reilly) bekommt, die gerade wegen einer unglücklich endenden Beziehung einen missglückten Selbstmordversuch hinter sich hat. Nicht nur dieser versucht Lavelle zur Seite zu stehen, da gibt es noch einen weiteren Selbstmordkandidaten (M. Emmet Walsh), für den der Father eine Pistole besorgt, einen verunglückten Touristen, dessen Witwe er beisteht, einen jungen Messdiener, aber auch eine Menge eher negativer Figuren wie seinen Kollegen, der eher zum Buchhalter als zum Geistlichen taugt, einen unglücklichen und ziemlich seltsamen Kunstsammler, einen zutiefst verabscheuungswürdigen Arzt usw.
In den zumeist kurzen Episoden (jede Figur erhält zwei bis vier Gespräche mit dem Father) wird nicht nur der bis auf eine Alkoholvergangenheit vorbildliche Charakter des Father herausgearbeitet, Regisseur und Drehbuchautor McDonagh übt sich auch in lakonisch humorvollen Dialogen, obwohl das Thema des Films ein eher ernstes ist. Wenn man sein Interview im Presseheft liest, ist kaum zu übersehen, dass McDonagh in der Öffentlichkeitsarbeit sehr an Aki Kaurismäki erinnert. Scheinbar ist die Vernichtung großer Mengen von Alkohol für ihn ein unerlässlicher Teil der Arbeit als Filmemacher, er behauptet gern, dass das Casting von den Caterern übernommen wurde und er nur dann ein sicheres Gefühl bei den Dreharbeiten hatte, wenn er den Kameramann schnarchen hören konnte, aber im selben Moment zitiert er als wichtige Einflüsse auch gern Robert Bresson oder wenig bekannte Philosophen.
Dass er für das Drehbuch von Calvary nur 19 Tage brauchte (eine überdurchschnittlich lange Zeit, er nimmt an, dass er besonders verkatert sein muss) und die Dreharbeiten 29 veranschlagten, passt da natürlich ins Bild, die Arbeit mit durchdachten Storyboards tut er als vermeintliche Comicadaption ab, und das einzige, worauf er wirklich stolz zu sein scheint, ist die logistische Feinarbeit bei der Koordination des Drehs mit dem großen Ensemble, das einerseits »Weltstars« beinhaltet wie Brendan Gleeson (Braveheart, Gangs of New York, Harry Potter), und seinen Sohn Domnhall (About Time, Anna Karenina), M. Emmet Walsh (What's up, Doc?, Blade Runner, Blood Simple), Chris O'Dowd (Bridesmaids, Thor: The Dark World) oder Kelly Reilly (Sherlock Holmes), sich andererseits aber auch auf viele irische »Lokaltalente« stützt, Komiker und Theaterdarsteller, die man fast nur dort kennt, beispielsweise Pat Shortt (Garage), Aiden Gillen (Shadow Dancer) oder Mark O'Halloran (Adam and Paul). Und natürlich Gary Lydon, der schon zum dritten Mal in der Rolle des Polizisten Gary Stanton in den Filmen McDonaghs auftaucht (jeweils mit einer etwas unterschiedlichen Ausprägung), und der auch im dritten Film der »Trilogie der Verherrlichung des Selbstmords« (hatte ich schon Aki Kaurismäki erwähnt?) wieder auftauchen wird. Dieser wird voraussichtlich The Lame Shall Enter First heißen.
Rein logistisch ist der Film bemerkenswert, doch die Mischung aus Dialogwitz, Spielfreude und bitterböser »Moral« (»There's no point killing a bad priest. But killing a good one, that'll be a shock«) zündet nicht recht (auch wenn ein Kollege nach der Vorführung sichtlich angetan war von der vermeintlichen »Logik«, ein Verbrechen an einem unschuldigen Messdiener an einem ähnlich unschuldigen Priester zu sühnen). Die Ausleuchtung hat mich auch etwas verwirrt, man benutzt auffallend viele warme Farben, oft aber in Situationen, die den Anschein erwecken wollen, natürlich ausgeleuchtet zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gewisse Aussage haben oder einfach nur dekorativer wirken soll.
Ein Film, der das Thema durchweg ernsthaft (und nicht so aufgebauscht) behandelt hätte, wäre mir lieber gewesen. Vielleicht auch eine »richtige« Komödie. Calvary ist ein Film für Freunde schauspielerischer Darstellungen. Wir hier ein gutes Dutzend Darsteller in jeweils wenigen Szenen Figuren kreieren, das ist interessant. Noch stärker hätte ich es zu schätzen gewusst, wenn auch die Geschichte langfristig interessant geraten wäre.

Bildmaterial © TOBIS Film Vorführungen:
|
American Hustle
(David O. Russell,
Berlinale Special)
USA 2013, Buch: Eric Warren Singer, David O. Russell, Kamera: Linus Sandgren, Schnitt: Alan Baumgarten, Jay Cassidy, Crispin Struthers, Musik: Danny Elfman, mit Christian Bale (Irving Rosenfeld), Amy Irving (Sydney Posser), Bradley Cooper (Richie DiMaso), Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld), Jeremy Renner (Mayor Carmine Polito), Louis C.K. (Stoddard Thorsen), Jack Huston (Pete Musane), Michael Peña (Paco Hernandez / Sheik Abdullah), Shea Whigham (Carl Elway), Alessandro Nivola (Anthony Amado), Elisabeth Rohm (Dolly Polito), Paul Herman (Alfonse Simone), Anthony Zerbe (Senator Horton Mitchell), Robert De Niro (Victor Tellegio), Dante Corbo / Santino Corbo (Danny Rosenfeld), Zachariah Stupka (Young Irv), 138 Min., Kinostart: 13. Februar 2014
Der neue Film von David O. Russell ist einer der Abräumer der Awards-Saison, die Golden Globes für Jennifer Lawrence und Amy Adams darf man als Indikatoren für zumindest einen Oscar verstehen, und man hat dabei ein wenig das Gefühl, dass die hehren Gestalten, die für Nominierungen und Preise verantwortlich sind, ein wenig auf Automatik geschaltet haben – ähnlich wie der Regisseur.
Wir erinnern uns: in den zwei vorherliegenden Filmen von Russell, The Fighter und Silver Linings Playbook, regneten auf die Darsteller immerhin drei Oscars. Christian Bale, Melissa Leo und Jennifer Lawrence waren hocherfreut, ein paar ihrer Co-Stars waren immerhin nominiert. Und für seinen neuen Film, bei dem man ein wenig das Gefühl hat, die Rollen wären den Darstellern auf den Leib geschneidert, trafen sich dann auch nahezu sämtliche Darsteller der früheren Filme wieder vor der Kamera. Wie ein kleines Klassentreffen. Und wenn man die Golden Globes als Prognose nimmt, wird es weitergehen mit dem Oscarregen.
Es gibt aber einen nicht geringen Unterschied zwischen The Fighter und Silver Linings Playbook auf der einen Seite und American Hustle auf der anderen. Zwar sind alle drei Filme sogenannte »Schauspieler-Filme«, bei denen sich Haupt- wie Nebendarsteller mal so richtig austoben können und ihr Können vorführen dürfen, aber die ersten zwei Filme erzählten dennoch auch von Figuren und Schicksalen. Da ging es um Hoffnungen und Probleme, um den Kampf für ein bisschen Selbstwertgefühl oder einen Lebensentwurf, wie wacklig er auch sein mag. American Hustle verschafft seinen Darstellern zwar Möglichkeiten, Emotionen darzustellen (u.a. Frust, Eifersucht, Wut, Lust, Überheblichkeit), und in manchen Momenten ist das auch ganz kolossal (etwa wenn Jennifer Lawrence mit gelben Plastikhandschuhen den alten Bond-Song Live and Let Die singt), aber größtenteils wirkt das sehr aufgesetzt. Übrigens ein sehr treffender Begriff, denn schon in der ersten Szene des Films beobachtet man Christian Bale dabei, wie er mit Klebstoff, Kamm, Spray und einem Haarteil sein Erscheinungsbild »frisiert«, eine ausgedehnte Vorbereitung auf eine Szene kurz darauf, wenn ihm Bradley Cooper diese Maskerade reichlich durcheinanderbringt. Man weiß zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenig von den Figuren, die die beiden darstellen (offensichtlich steht Amy Adams zwischen den beiden Männern, und auch, wenn sie sich ein wenig ähneln, möchte keiner von ihnen dies gern hören), aber als Humoreffekt aus einer komplexen »Entstellung« des ansonsten auf Heldenfiguren wie Bruce Wayne und John Connor abonnierten Bale funktioniert die Glatzenenttarnung wohl. Leider kommt der Film nur selten über dieses Humor-Niveau hinaus, und man fragt sich irgendwie, wozu man Christian Bale engagiert, wenn Tom Cruise (Tropic Thunder) oder Christian Ulmen mit Haarteil und umgeschnalltem falschen Wanst es auch getan hätten.
Vielleicht reicht es in Hollywood schon, wenn man den lieben Kollegen dabei zuschauen darf, wie sie wirklich viel Spaß bei den Dreharbeiten haben. Solange der Film dabei auch noch erfolgreich ist. Mir persönlich reicht das nicht einmal ansatzweise.
American Hustle ist ein Film, der im Jahr 1978 spielt und sich auch reichlich auf seinen nostalgischen Soundtrack stützt. Im Gegensatz zu den Frisuren war die Musik damals auch besser. Donna Summer in der Disco oder der gerade verstorbene Duke Ellington als Indiz, dass sich zwei »Soulmates« gefunden haben. Die Hauptfiguren sind nicht unbedingt sehr sympathisch, die Sympathie kommt eher von den Darstellern her. Irving Rosenfeld (Christian Bale) ist ein Gauner, der bevorzugt von den Verzweifelten raubt und einen gewissen Stolz dabei empfindet, dass dei Versprechungen, die er »verkauft«, aber auch so gar keine Basis haben. Sydney Prosser (Amy Adams) ist ein Landei, das groß rauskommen will und offenbar ein großes schauspielerisches Talent hat, denn »von gleich auf jetzt« kann sie nicht nur dem »Cosmopolitan«-Büro weismachen, dass sie etwas von Journalismus verstehe, sie kann auch über lange Zeiträume einen britischen Akzent und ein mondänes Neureichen-Gehabe vortäuschen. Warum das so ist, wird im Film nie erklärt. Richie DiMaso (Bradley Cooper) ist ein Strahlemann von FBI-Agent, der ganz groß herauskommen will, aber ein wenig begriffsstutzig ist. Und Rosalyn Rosenfeld (Jennifer Lawrence) ist eine »nichtpraktizierende Hausfrau«, die es im kleinen Haushalt mit ihrem Sohn in kurzer Zeit mehrfach schafft, Brände zu entfachen.
Aber wenn liebgewonnene Schauspieler dumme und moralisch verwerfliche Figuren spielen, scheint das wohl für Teile des Publikums ein Riesenspaß zu sein. Ich habe das schon bei Burn After Reading nicht verstanden, und hier verstehe ich es noch weniger. Es gibt ja auch eine Geschichte, aber verglichen damit sind etwa Barney's Version (Paul Giamatti hat tatsächlich einen Bauchansatz und Probleme mit dem Haarwuchs – und das macht ihn weitaus sympathischer als Mr. Bale) oder Charlie Wilson's War zumindest interessant. Bei American Hustle ist die innovativste Idee des Drehbuchs wohl der Besitzer einer Wäschereien-Kette, der über unabgeholte teure Kleider das Herz (naja, was man halt so nennt) seiner Angebeteten gewinnt. Abgesehen davon geht es um – der Titel sagt es schon – »Hustler«, also Trickbetrüger, und wer keinen der artverwandten Filme gesehen hat, die seit The Sting (deutsch: Der Clou) so etwa zweimal im Jahr auf die deutschen Kinoleinwände kommen, der mag sich von einigen Handlungssträngen des Films auch noch »überraschen« lassen. Für mich war das überraschendste an American Hustler neben meinem eigenen kompletten Desinteresse (vor Sichtung des Films zweifelte ich noch an der Intelligenz aller Nörgler) das in seiner Verlogenheit außergewöhnliche »Happy End« des Films.
Ich halte mich mit Superlative zum Jahresbeginn eigentlich eher zurück, aber American Hustler dürfte wohl der am meisten überschätzte Film sein, der 2014 in Deutschland startet. Auch falls er noch drei oder vier Oscars hintergeworfen bekommen sollte: unbedingt meiden. Außer wenn man sich an bescheuerten Frisuren aufgesetztem Schauspiel, tiefen Dekolletés und gelegentlich gelungenen Dialogen allein schadhaft halten kann. Und nicht vergessen: David O. Russell hat auch I heart Huckabees gedreht. Erinnern sie sich daran, wie ihnen der gefiel, und sie haben eine ziemlich gute Tendenz, ob sie dem aktuellen Hype glauben sollten oder lieber nicht.
The Better Angels
(A.J. Edwards, Panorama)
USA 2014, Buch: A.J. Edwards, Kamera: Matthew J. Lloyd, Schnitt: Alex Milan, Music: Hanan Townshend, Kostüme: Lisa Tomczeszyn, mit Jason Clarke (Tom Lincoln), Brit Marling (Nancy Lincoln), Diane Kruger (Sarah Lincoln), Braydon Denney (Abe), Cameron Mitchell Williams (Dennis Hanks), Wes Bentley (Mr. Crawford), McKenzie Blankenship (Sally), Lola Cook (Frail Child), Casey Roberts (Neighbor Boy), Robert Vincent Smith (Reverend Elkins), 94 Min.
Manchen Leuten kann man es nicht recht machen. Bei Frances Ha und Nebraska habe ich an der Schwarzweißfotografie herumgemäkelt, weil sie sich nicht ansatzweise auf die ästhetischen Stärken besinnt, die man etwa aus den Filmen von Gordon Willis oder Michael Chapman kennt. In The Better Angels hat Kameramann Matthew J. Lloyd all jenes offenbar beherzigt. Nur leider wirkt das Ergebnis hier oft pittoresk bis kunstgewerblich, vieles ist dann zu perfekt, wirkt wie jene kommerziellen Plakate, die sich ganz auf die Stärken der Schwarzweiß-Fotografie stützen, wobei im Medium Film noch andere Allgemeinplätze hinzukommen. Neben den starken Kontrasten (der typische Türenmoment aus John Fords The Searchers darf nicht fehlen) geht es hier um Sonnestrahlen, die sich in der Linse verirren, züngelnden Rauch, Haare, die im Wind flattern, Staubflusen oder auch die Texturen von barkigen Baumstämmen oder rauhem Stoff, die man gern aus der Nähe einfängt. Wobei man es sich aber nicht nehmen lässt, die Schärfeeinstellung nachträglich noch hochzufahren, um noch mehr angeben zu können.
Schön früh in diesem Film, der übrigens die Jugend von Abraham Lincoln schildern soll, fühlte ich mich an Terrence Malick erinnert, aber leider nicht im positiven Sinne. Erst beim Nachspann erfuhr ich, dass Malick hier sogar Koproduzent war, und der Regisseur, A.J. Edwards, hat offensichtlich eine Ausbildung genossen, die sehr von Malick geprägt war. 2005 bei The New World war Edwards Praktikant beim Schnitt und »camera operator« des nebenbei entstandenen Dokumentarfilms Making 'the New World', 2011 bei The Tree of Life »key artistic consultant« (was auch immer das beinhaltet) und 2012 bei To the Wonder einer der fünf Cutter.
Und leider bedient sich The Better Angels so ziemlich aller Merkmale, die man aus den Filmen Malicks kennt, kommt aber leider zu keinem Zeitpunkt an die lyrischen Qualitäten heran, die Malick zumindest in seinen Frühwerken wie Badlands auszeichneten. So geht es auch hier um die Unschuld der Jugend, um die reine Liebe (hier zu Lincolns Mutter bzw. einer von Diane Kruger gespielten Ersatzmutter), um die Poesie der Natur, doch der ganze Film erreicht schnell eine starke Ärgerlichkeit durch seine visuelle Großkotzigkeit und den didaktischen Tonfall, der aber eine gewisse Intelligenz, die man noch in den misslungeneren Malick-Werken spürt, vermissen lässt.
Da gibt es etwa die für Malick fast obligatorische Voice-Over-Erzählung, die hier ein etwas älterer Cousin Abes übernimmt. Irgendwann sieht man den auch mal, er wirkt wie ein schlanker, junger Leonardo DiCaprio. Seine Stimme hingegen repräsentiert einerseits die simple Herkunft der Lincoln-Familie »I knowed him«, wird aber vom Film gern dazu missbraucht, das Wissen diverser Geschichtsbücher in den Film hineinzutrichtern (»he learned Henry Clays speeches by heart«). Der Cousin ist komplett unglaubwürdig, niemals eine nachvollziehbare Figur, sondern eher die gestalterisch bearbeitete (schlechtes Englisch) Version eines Kommentators in einem Dokumentarfilm.
Denn auch, wenn der Film versucht, authentisch und kraftvoll daherzukommen, ist die ganze Lincoln-Kiste doch ein Schuss in den eigenen Fuß. Nicht nur darf der traumatische Moment nicht fehlen, an dem der junge Abe im Wald einigen Sklavenjägern nebst »chain gang« begegnet, auch wird über Küchenpsychologie erklärt, wie durch den pädagogischen Zuspruch der beiden Mütter aus Abe »Honest Abe« wurde. Der Höhepunkt an Dummdreistigkeit ist es, wie die Stiefmutter und ein neuer Lehrer (Wes Bentley) quasi sofort erkennen, dass aus dem Jungen noch eine wichtige Person werden wird, weswegen sie ihn (natürlich uneigennützig und aufopfernd) unterstützen. Von Vergleichsfilmen, die kräftige Emotionen und Naturgewalt thematisieren, wie Andrea Arnolds Wuthering Heights oder Kelly Reichardts Meek's Cutoff, ist dieser Streifen hingegen weit entfernt. Es nervt einfach nur. Dazu gesellt sich ein ebenso prätentiöser Soundtrack, der neben einem Mundorgelstück und etwas vermeintlich traditionellem Folk vor allem Klassik vorführt, die aber (ich habe einen Experten befragt) nicht einmal wie bei Barry Lyndon zeitgenössisch ist, sondern vor allem dekorativ. Vielleicht hat ja sogar der teilweise fragmentarisch wirkende Schnitt in den Kinderszenen (es widerstrebt mir, hierfür den Begriff Jump-Cut zu benutzen, das würde das Ganze nur aufwerten) eine tiefere Bedeutung, auf mich wirkte er nur so, als hätte das Material nicht mehr hergegeben, was für die schwere Jugend des späteren US-Präsidenten repräsentativ gewirkt hätte. Verglichen damit gibt es halt Regisseure, die bei Jungdarstellern wahre Meisterleistungen initiieren, während man hier eher das Gefühl hatte, die Jungs und Mädchen wurden in Kostüme gesteckt und dann gefällig im Bild verteilt. Und die Montage wird's schon richten und durch das Voice-Over in Filmkunst verwandeln. Weit gefehlt.
| satt.org | Literatur | Comic | Film | Musik | Kunst | Gesellschaft | Freizeit | SUKULTUR |
 107:
107: